Was sind Fette? - Verdauung, Wirkung, Funktion und Ernährung (Teil 2 von 3)
Veröffentlicht am 29.04.2025
Hallo und Willkommen zum zweiten Teil meiner großen Artikel-Serie zum Thema
"Was sind Fette?".
In den ersten Teil haben Sie ja nun kennen gelernt welche unterschiedliche Fette und Fettsäuren es so gibt, wie sie chemisch aufgebaut sind, wo sie vorkommen und was es mit den Cholesterin auf sich hat.
Das alleine waren ja schon eine große Menge an Informationen!
Und nun geht es vertieft weiter!
Denn in diesen Teil gehe ich auf folgende Fragen ein:
- Wie funktioniert eigentlich die Fettverdauung und der Fett-Stoffwechsel?
- Für was benötigt der Körper die Fette?
- Welche Fette sind wichtig und gesund und welche sollten wir besser meiden?
Genau so gehen wir die Sache jetzt an.
Sind Sie bereit?
Gut. :-)
Ich dachte mir, bevor ich auf die Funktion der verschiedenen Fette eingehe, beschreibe ich doch erst einmal den Fettstoffwechsel, bzw. die Fettverdauung. Denn das wäre quasi ja auch die richtige Reihenfolge wenn wir Lebensmittel essen. Denn die Fette gelangen ja erst in den Körper, wenn wir das Lebensmittel gegessen haben, Dann werden die Fette verdaut und anschließend bewirken sie was im Körper. Wenn es gute Fette sind, dann macht der Körper was Gutes damit, wenn es die schlechten Fette sind, dann geschehen eher ungünstige Vorgänge im Körper.
Wie funktioniert die Fettverdauung und der Fettstoffwechsel?
Stellen Sie sich vor, Sie essen jetzt ein Lebensmittel, welches gute Fette enthält - z.B. Mandeln, Nüsse, Avocdos.. oder was auch immer.
Jetzt zerkauen Sie - im Optimal-Fall "richtig gut" - das Lebensmittel, wodurch die dort enthaltenen Stoffe Kontakt mit den Speichel bekommen. Im Speichel befinden sich einige verschiedene Verdauungsenzyme - also gewisse Stoffe, die die Stoffe aus den Lebensmittel im ersten Schritt auseinander nehmen. Deswegen fängt die Verdauung bereits im Mund an, und deswegen sollten wir uns angewöhnen richtig zu kauen. Um mal ein Beispiel zu nennen, was ja schon recht bekannt geworden ist: Im Speichel befindet sich - unter anderem - Enzyme mit der Bezeichnung "Alpha-Amylasen"- Diese Enzyme zerkleinern Stärke - also die einfachen Kohlenhydrate wie sie z.B. in Kartoffeln, Mais und Getreide enthalten sind. Kommt dieses Enzym mit dieser Stärke in Berührung, dann wird es so zerkleinert das die Stärke flüssig wird. Die Stärke wird in ihre einzelnen Bestandteile gespalten. Das dies so ist, können Sie sogar ganz einfach sichtbar machen. Kochen Sie sich mal ein Pudding. Denn Pudding besteht üblicherweise nur aus (Mais)-Stärke und Farbstoff und Geschmacksstoffe. Ok, ein Schokopudding besteht aus Stärke und Kakao. Der Vanillepudding wird mit dem Farbstoff Beta-Carotin gelb gefärbt - hat also nichts mit Vanille zu tun. Wie auch immer. Wenn der Pudding abgekühlt und Fest ist, dann - Achtung "lecker" - spucken Sie mal in ihr Schälchen hinein und rühren kurz um. Dann warten Sie einen Moment. Sie werden nun feststellen das der Pudding allmählich wieder flüssig wird. Die Amylasen in Ihr Speichel spalten die Stärke-Moleküle auf. Das kann übrigens auch passieren, wenn Sie eine etwas größere Menge Pudding essen und sich dabei etwas mehr Zeit lassen. Denn an dem Löffel, den Sie ja im Mund nehmen und dann immer wieder in den Pudding tunken, klebt ja immer wieder etwas Speichel dran, welcher dann in Kontakt mit der Stärke im Pudding kommt. Deswegen wird der Pudding auch auf dieser Weise allmählich immer flüssiger. Doch da wir ja meisten etwas schneller essen, fällt das nicht so auf. Auf jeden Fall passiert das nun auch in Ihrem Mund mit der Stärke, die Sie essen. Deswegen ist es ratsam gut zu kauen. So können dann auch die Kartoffeln, das Getreide - oder was auch immer - gut vor-verdaut werden und so optimal vorbereitet im Magen ankommen. Denn schlucken wir die Nahrung in zu großen Stücken herunter, kann dieser Vorgang so nicht mehr wiederholt werden. Im Magen werden die Amylasen deaktiviert. Erst später im Dünndarm wird dieses Enzym noch einmal zur Verfügung gestellt. Wenn die Nahrung aber schlecht vor-verdaut im Darm ankommt, schafft er es nicht mehr die Nahrung gänzlich klein zumachen. Also kann sich der Körper dann noch damit behelfen die groben Nahrungsreste zu fermentieren. Und das führt dann allerdings zu einer großen Gas-Entwicklung. Naja, was das bedeutet, können Sie sich ja nun denken. :-)
Ok, jetzt habe ich aber über Kohlenhydrate gesprochen. Es geht hier aber um Fette.
Welche Enzyme im Speichel werden denn nun für die Fette verwendet, und wie funktioniert dieser Vorgang?
Das schauen wir uns jetzt an und gehen dabei diesen Vorgang der Verdauung mal schrittweise durch.
-- Station 1 - Mund
Nun tatsächlich ist es bei den Fetten ein wenig anders. Hier gibt es ein Enzym, dass sich "Zungengrundlipase" nennt - also ein Lipase-Enzym. Dieses Enzym spaltet bevorzugt kurzkettige Fettsäuren aus Milchfetten ab. Dies ist jedoch nur bei Säuglingen der Fall, da bei den Babys die Pankreasfunktion (Bauchspeicheldrüse) noch nicht vollständig ausgebildet ist, weshalb die Lipase aus Mundhöhle und Magen hier einen wichtigen Beitrag zur Fettverdauung leistet. Bei Erwachsenen ist das nicht mehr der Fall, da die Bauchspeicheldrüse diese Lipasen nun bereitstellt.
-- Station 2 - Magen
Nachdem also die Nahrung von dem Mund in den Magen gelangt ist, wird diese nun im Magen weiter verarbeitet. Die Fette sind dabei ja nicht gleichmäßig im Speisebrei verteilt, sondern liegen in größeren Tropfen zusammen. Der Magen macht jetzt rhythmische Bewegungen, wodurch die großen Tropfen in kleinere Tröpfchen zerteilt werden und somit auch für eine bessere Verteilung gesorgt wird. Diesen Vorgang nennt man auch Emulgierung. Dabei geht es also darum, zwei Stoffe, die eigentlich nicht miteinander mischbar sind - hier die Fette und der restliche zerkaute Speisebrei - miteinander zu vermischen. Jetzt sind die Fette gut vorbereite, damit sie im Darm weiter verarbeitet werden können.
-- Station 3 - Dünndarm
Jetzt geht es also weiter im Dünndarm, und hier findet der Hauptteil der Fettverdauung statt. Die Fetttropfen müssen nun noch weiter zerkleinert werden. Dieser Prozess wird jetzt mit den weiter oben angesprochenen Lipasen vorangetrieben. Die Bauchspeicheldrüse stellt jetzt diese Lipasen zu Verfügung. Lipasen sind Enzyme, die die Fähigkeit haben, Lipide (Fette und Fettähnliche Stoffe - siehe Teil 1) zu spalten, sie also von den Fettsäuren zu trennen. Doch damit dieser Vorgang geschehen kann, müssen die Fette noch weiter emulgiert werden. Denn auch wenn sie schon zu einer gewissen Art vor-emulgiert worden sind, besteht aber das Problem das die Fett-Tropfen eine noch zu hohe Oberflächenspannung haben und somit nicht enzymatisch von den Bachspeicheldrüsen-Lipasen auseinandergenommen werden können. Doch wie werden diese Fett-Tropfen jetzt noch kleiner gemacht? Nun, hier kommt der Gallensaft ins Spiel, welcher aus der Gallenblase kommt. Dieser Gallensaft sorgt mir seinen Inhaltsstoffen - den Gallensäuren - dafür, dass die Fetttropfen weiter auseinander gesprengt werden und somit noch kleiner werden und die Oberflächenspannung verloren geht. Sobald dies geschehen ist, aktiveren die Gallensäure die Bauchspeicheldrüsen-Lipasen, welche dann die kleinen Tröpfchen chemisch spalten können. Die Spaltung erfolgt also nun in Glyceride und Fettsäuren. Sie wissen ja nun aus dem 1. Teil dieser Serie, dass Nahrungsfette eine Verbindung aus Glycerin und 3 Fettsäuren sind (= Triglyceride). So zerkleinert und gespaltet können die Fette nun von der Darmwand aufgenommen werden.
Übrigens - nur mal so nebenbei: Ich habe ja gerade gesagt, dass Gallenblase die Gallensäure bereitstellt um die Fette weiter zu spalten.
Doch was ist denn nun mit den Menschen, die keine Gallenblase mehr haben, weil man denen die Gallenblase herausoperiert hat?
Nun, was die Fettverdauung angeht, kann der Körper tatsächlich weiterhin Fette verarbeiten, denn:
Die Gallenflüssigkeit (oder auch kurz: die Galle) wird nämlich in der Leber produziert und dann in der Gallenblase gespeichert. Der menschliche Körper produziert in der Leber täglich etwa 600-700 ml dünnflüssige Gallenflüssigkeit, auch Lebergalle oder Primärgalle genannt, die in der Gallenblase auf etwa zehn Prozent ihres Volumens eingedickt wird.
Diese konzentrierte Gallenflüssigkeit ist je nach Anteil der Gallenfarbstoffe - namens Bilirubin und Biliverdin - gelblich bis grünlich und kann stark eingedickt auch bräunlich werden. Sie wird bei Bedarf (z. B. nach einer fetten Mahlzeit) direkt in den Zwölffingerdarm abgegeben.
Hat die Gallenflüssigkeit ihre Aufgabe im Darm erfüllt, gelangt ein Großteil, mehr als 90 %, über den Blutweg wieder in die Leber. Dort wird sie ergänzt und gelangt dann wieder in die Gallenblase. Diesen Kreislauf nennt man den "enterohepatischen Kreislauf" zwischen Darm und Leber.
Wer keine Gallenblase hat, kann meistens relativ "normal" weiterleben, sofern man es mit den Fett-essen nicht übertreibt. Normalerweise reicht die Gallenflüssigkeit, die die Leber frisch produziert, für eine Mahlzeit aus. Wer aber gern üppig und besonders fettreich isst, kann ohne Gallenblase Problemen bekommen. Dann kann es zu Völlegefühl und Durchfall kommen, weil die Fettverdauung nicht mehr ausreichend mit Gallensaft unterstützt wird. Nötigenfalls kann es sein, dass man mit dem einen oder anderen fettreichen Lebensmittel etwas vorsichtiger sein muss. Der Körper hat ja jetzt keine Speicherfunktion mehr, mit dem er den Gallensaft speichern kann. Dadurch kommt es dann auch vor, dass immer wieder Gallensäfte in den Zwölffingerdarm gelangen, egal ob eine Mahlzeit zu verdauen ist oder nicht. Dadurch können die Schleimhäute dauerhaft gereizt werden, was bei manchen Patienten zu Durchfall führen kann.
Wenn aber eine Mahlzeit verdaut werden soll, dann kann es auch mal vorkommen, dass dann zu wenig Gallenflüssigkeit vorhanden ist. Wenn es sich bei der Mahlzeit um eine durchschnittlich üppige Mahlzeit handelt, ist die Gallenflüssigkeit der Fettmenge nicht gewachsen und es ist zu wenig Galle vorhanden um alle Fette aufzuspalten. Dadurch gehen neben ungesunden auch die gesunden Fette nicht in die Verdauung über. So kann es dann zu einem Mangel kommen, der Nägel, Haut, das Energieniveau und weiteres in Mitleidenschaft zieht. Also ist es nicht immer so, dass man "weiter essen kann wie bisher" - vor allem dann nicht wenn die bisherige Ernährungsweise nicht gerade so gesund war. Durch ein Mangel an Gallenflüssigkeit können eben nicht alle Mahlzeiten gleich gut verdaut werden.
Bei einem Leben ohne Gallenblase sollte man ein paar Ernährungstipps beachten, z.B. kann man kleinere Portionen auf mehrere Mahlzeiten verteilt essen, die ungesunden fettreichen Mahlzeiten weglassen (sowieso, egal mit oder ohne Gallenblase), nicht zu fettreich essen und auf gute Ballaststoffreiche Ernährung achten.
Wichtige Nahrungsmittel in einem Leben ohne Gallenblase sind frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Fruchtsäfte, Ganze Körner, keine Kuhmilch sondern eher Reismilch, Olivenöl und Brauner Reis. Wichtig dabei ist auch, dass genügend reines Wasser getrunken wird.
So, kommen wir aber nun zurück zu den einzelnen Schritten der Verdauung und schauen wir uns den nächsten Schritt an.
-- Station 4 - Darmwand
Jetzt sollten die Fett-Tropfen von der Darmwand aufgenommen werden. Aber noch geht das nicht. Warum? Weil die Fettsäuren nicht wasserlöslich sind. Sie sind zwar nun gespalten, aber sie können sich nicht im Wasser lösen. Obwohl, das gilt nur für die Langkettigen Fettsäuren. Denn Kurz- und mittelkettige Fettsäuren sind relativ gut wasserlöslich und gelangen ohne enzymatische Spaltung über das Pfortaderblut direkt zur Leber, wo sie dann abgebaut werden. Für die Langkettigen Fettsäuren wird von der Gallensäure eine wasserlösliche Hülle "bereit gestellt". Die Gallensäure legt sich wie ein Mantel um die Fette bzw. ihre Bestandteile. Weitere Bestandteile dieses "Mantels" sind auch Lecithine und Cholesterol. Dieses 3 Stoffe nennt man auch Gallenseifen. Solche vollständigen Gebilde aus einem fettigen Kern und einer wasserlöslichen Außenhülle werden auch "Mizellen" genannt. So verpackt können diese langkettigen Fette in die Zellen des Dünndarms aufgenommen werden, von wo sie schließlich in den Blutkreislauf gelangen.
Der Weitertransport
Wie das Innere der Körperzellen besteht auch das Blut hauptsächlich aus Wasser. Es kann also keine Fette auflösen. Deshalb stellt der Körper spezielle Transport-Moleküle zu Verfügung, damit die Fette durch den Blutkreislauf zu den Organen gelangen können, für die sie bestimmt sind. Diese Transport-Moleküle, welche sich nun an die Mizellen haften, bestehen aus Eiweiße. Während dieses gesamte Paket nun transportiert wird, geben sie auf ihrem Weg durch den Blutkreislauf Fette ab und nehmen andere wieder auf. Dieser Komplex aus Fettpartikel und Transport-Eiweiß wird Lipoprotein genannt (Zusammensetzung aus "Lipide" und "Protein"). Während diese Lipoproteine durch den Blutkreislauf wandern, verändern sie sich also mehrmals. Deshalb unterscheidet man verschiedene Sorten Lipoproteine.
1. Chylomikronen
Das größte Lipoprotein heißt "Chylomikron" und enthält vor allem Triglyceride. Das Wort "Chylomikron" setzt sich zusammen aus dem griech. "chylos" = "Saft" und "mikros" = "klein"). Seine Reise durch den Körper dauert nur etwa 30 Minuten, bis es seine Endstation - die Leber - erreicht. In dieser Zeit verteilt es die im Darm aufgenommenen Nahrungsfette wie Triglyzeride und Cholesterin an die Muskeln und Fettdepots des Körpers, wo sie verarbeitet oder gespeichert werden.
Chylomikronen haben ein Durchmesser von 0,5 bis 1,0 Mikrometer und eine Dichte von unter 1,000 g/ml. Diese werden also vom Dünndarm über die Lymphe in die Blutbahn abgesondert. Ihr Kern enthält hauptsächlich Triacylglyceride, sowie eine im Vergleich geringe Menge an Cholesterinestern (chemische Verbindungen zwischen Cholesterin und verschiedenen Fettsäuren).
Die Chylomikronen transportieren die im Darm aufgenommenen Nahrungsfette unter Umgehung der Leber über das Lymphsystem in den großen Blutkreislauf und haben in etwa folgende Zusammensetzung:
1 % Eiweiß
4 % Cholesterin und Cholesterinester
5 % Phospholipide
90 % Triglyceride
In den Kapillaren des Fett- und Muskelgewebes spaltet die Lipoproteinlipase einen Großteil der in den Chylomikronen enthaltenen Triglyceride.
Die Lipoproteinlipase (LPL) ist ein wasserlösliches Enzym, welches in der Leber hergestellt (synthetisiert) wird. Auch diese Lipase hat die Aufgabe, die im Blut gelösten und an Eiweiß-Fett-Komplexe gebundenen Fettsäurespeicher, die Triglyceride, in zwei Fettsäuren und Monoacylglycerin zu spalten und so für den weiteren Stoffwechsel nutzbar zu machen.
Wie die Pankreaslipase (Bauchspeicheldrüsen-Lipase) und andere Lipasen befindet sie sich außerhalb von Zellen. Deshalb bezeichnet man sie auch als extrazelluläre Lipasen. Das durch die Spaltung freiwerdende Glycerin kann in der Leber weiter verstoffwechselt werden, während die Fettsäuren von den Zielzellen (z.B. in den Muskeln) aufgenommen werden. So kann die Versorgung von Fettzellen mit Fettsäuren gesichert werden. Angeregt wird die Lipoproteinlipase durch Insulin, welches ja von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Die in der Blutbahn zurückbleibenden Partikel, die nun einen stark erhöhten relativen Cholesteringehalt haben, werden als Chylomikronen-Remnants (engl. Überbleibsel) bezeichnet.
Sie sehen also, es passiert hier schon einiges. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Fette zuerst zerkleinert werden (im Magen), dann im Dünndarm noch einmal mithilfe von Gallensaft zerkleinert werden, anschließend mit einem Enzym der Bauchspeicheldrüse (Lipase) gespaltet werden in ihre Bestandteile - wie eben Glycerin und Fettsäuren. Kurz- und Mittelkettige sind relativ gut wasserlöslich und gelangen ohne enzymatische Spaltung über das Pfortaderblut direkt zur Leber, wo sie dann abgebaut werden. Langkettige Fettsäuren werden mit einer Außenhülle ummantelt, die aus Gallensäure, Cholesterol und Letzthin besteht, damit diese Fettsäuren wasserlöslich werden. Somit können diese dann über die Darmwand in den Blutkreislauf transportiert werden. Doch damit diese im Blut transportiert werden, werden Eiweiße an diese Hülle dran gehängt. Damit haben wir einmal die Chylmikronen und zwei weitere Lipoproteine, auf dich ich gleich näher eingehen werde.
Wenn es Sie interessiert, dann können Sie sich noch weiter einlesen aus welchen Bestandteilen die Phospholipide bestehen. Zum Beispiel besteht die Cholesterin-haltige Phospholipidhülle aus einem Protein namens "Apolipoprotein B-48", und noch einige weiterer solcher Proteine. Jedoch aber ist es für diesen Artikel hier nicht notwendig so weit ins Detail zu gehen und würde auch nur zu viele chemische Fachwörter und Erklärung mit hineinbringen, sodass dieser Artikel dann doch zu komplex und schwierig zu lesen wird. Wenn Sie aber wollen, dann können Sie diese Infos unter folgendes Artikeln finden:
Chylomikron - Wikipedia
Apolipoprotein - Wikipedia
Auf jeden Fall werden durch Lipasen, die sich in den Fett- und Muskelgewebe befindet, die Triglyceride aus den Chylomikronen wieder abgespaltet.
So, und wie weiter oben bereits gesagt, können sich die Lipoproteine mit der Zeit verändern. Die Chylomikronen sind die größten Lipoproteine. Die zweitgrößten Lipoproteine sind die "Lipoproteine mit sehr niedriger Dichte". Oder auch englisch gesagt: "Very low Density Lipoprotein".
Very Low Density Lipoprotein - oder abgekürzt "VLDL"
In der Leber angekommen, werden die restlichen Fette aus den Chylomikronen sowie weitere Fette und das Cholesterin, das die Leber gebildet hat, in die etwas kleineren VLDL-Lipoproteine umgebaut und erneut durch den Blutkreislauf geschickt. Dabei bringen die VLDL weitere Triglyzeride zum Fettgewebe, wo sie als Energiereserve gespeichert werden. Die Lebensdauer der VLDL beträgt zwei bis vier Stunden. Der Lipidanteil von VLDL liegt bei 85-90 %, ihr Proteinanteil dementsprechend bei 10-15 %.
Und spätestens jetzt kommt Ihnen dieser Begriff doch bekannt vor, oder?
Genau, davon ist ja die Rede wenn es um das Thema "Cholesterin" geht. Und genau hier schließt sich der Kreis nämlich!
Nachdem die Fette also zerkleinert und durch den Dünndarm gewandert sind, mit Transportmoleküle versehen worden sind, befinden wir uns jetzt bei den Thema "HDL", "LDL" oder eben wie hier "VLDL". Denn wie auch schon beim Cholesterin-Thema im letzten Absatz des ersten Teils dieser Artikel-Serie gesagt, sind diese "Stoffe" (LDL, HDL, VLDL) eben Fette, die mit Transport-Eiweiße versehen sind - also eben (wie mehrfach bereits erwähnt) Lipid-Proteine, bzw. Lipoproteine.
Das VLDL-Transportpaket gibt also immer wieder Triglyceride ab, während es durch den Blutkreislauf wandert. Diese Fette werden zur Energiespeicherung gebraucht. Nachdem das VLDL-Paket also eine gewisse Menge an diese Triglyceride verloren hat, wird daraus nun das LDL. Denn jetzt ist die Dichte weniger geworden. Also: Mehr Triglyceride = stärker verdichtetes Paket - und damit auch ein größeres Paket, da eben mehr Fette vorhanden sind.
Low Density Lipoptrotein - oder abgekürzt "LDL"
LDL- Pakete bestehen zu fast 50 Prozent nur noch aus Cholesterin. In diesem Zustand bezeichnet man sie als LDL-Cholesterin. LDL-Cholesterin nehmen die Körperzellen über bestimmte Bindungsstellen auf. Es verbleibt bis zu zwei Tage im Blut, sodass der Körper es als rasch verfügbare Cholesterinspeicher nutzen kann. Menschliches LDL hat eine Dichte von 1,019 bis 1,063 g/ml und eine Größe von 18 bis 25 nm (im Durchschnitt 22 nm).
Also, mit diesen Paket werden die restlichen Triglyceride, aber auch enthaltenes Cholesterin, abgegeben.
Nachdem nun die gegessenen Fette verdaut worden sind und mittels Transportmoleküle zu den Organen oder Gewebe gebracht worden sind, gibt es nun auch einen umgekehrten Weg - nämlich dann, wenn das überschüssige Cholesterin aus den Zellen zurück zur Leber gebracht werden muss. Dieser Aufgabe übernimmt das Lipoproteine mit der höchsten Dichte - HDL.
High Density Lipoprotein - oder abgekürzt HDL
Menschliches HDL hat eine Dichte von 1,063 bis 1,210 g/ml und eine Größe von 5 bis 17 nm. Es gehört damit zu den kleinsten und dichtesten Lipoproteinen des Menschen. Größe und Dichte sind - wie gesagt - abhängig von der Menge an Lipid und Protein, mit denen HDL beladen ist. HDL hat einen hydrophoben (= wasserliebenden) Kern, in dem vor allem Cholesterinester und ein geringer Anteil Triglyzeride sowie unverestertes Cholesterin vorhanden sind. Die hydrophile Hülle wird vor allem aus Phospholipiden und unverestertem Cholesterin gebildet. Hergestellt wird das HDL vom Körper im Darm, in der Leber oder im Blut bei der Verstoffwechselung anderer Lipoproteine.
Wenn also nun das überschüssige Cholesterin zurück zur Leber gebracht wird, wird es dort dann teilweise zu Gallensäuren umgewandelt oder direkt als Cholesterin mit der Gallenflüssigkeit über den Stuhl ausgeschieden. HDL verfügt also über die Fähigkeit, Cholesterinmoleküle, die sich bereits an die Gefäßwände geheftet haben, wieder zu lösen und in Richtung Leber abzutransportieren. Dadurch kann es auch der Entstehung von Gefäßverengungen entgegenwirken. HDL-Cholesterin hat die längste Lebensdauer. Bevor es abgebaut wird, kann es bis zu vier Tage im Blut bleiben.
Wie werden Fette nun abgebaut?
Überschüssige Triglyzeride speichert der Körper im Fettgewebe. Sie dienen als Energiereserve, auf die der Körper bei Bedarf zurückgreifen kann. Die Fettreserven werden auch bei einem Energiemangel abgebaut, also wenn wir längere Zeit nichts gegessen haben. Vor allem ein niedriger Blutzuckerspiegel regt die Fettdepots dazu an, Triglyzeride freizusetzen. Die Leber nutzt die Energie aus diesen Fetten, um selbst Zucker herzustellen.
Soo..
.. und damit haben wir nun also die Fett-Verdauung erklärt - von dem Essen der Fette bis hin zur Verteilung der Fette im Körper, zusammen mit den Cholesterin. Sie sehen also, dass Cholesterin auch nötig ist um die Fette zu den Bereichen des Körper zu bringen. Insofern kann es ja gar kein Sinn machen, dass es irgendwie eine "böse Art" von Cholesterin geben kann. Es kann gar nicht verhindert werden, dass der Körper Cholesterin herstellt und benutzt, wenn wir gute Fette essen. Das benötigt er - neben anderen Stoffen - für die Verstoffwechselung. Diese anderen Stoffe sind auch Stoffe wie die verschiedenen Apolipoproteine, auf die ich hier aber nicht weiter eingehen will, da das ganze Thema sonst wie zu komplex, unübersichtlich und mit zu viele Fachbegriffen vollgestopft wird. Sie können sich das unter den Wikipedia-Link durchlesen - oder auch woanders im Netz, falls Ihnen das interessiert- aber für das Verständnis von Fetten in diesen Artikel und in dem ersten Teil ist das jetzt nicht nötig. Das ist eher für die Chemiker interessant.
Deutlich wird also nun, dass das LDL an sich nicht schädlich sein kann. Es wird ja benötigt um Fette zu verdauen, bzw. es entsteht um Fette zu verdauen. Wenn Sie also kein LDL mehr haben wollen im Körper, dann müssen Sie ab sofort aufhören Fette zu essen - in jeglicher Form! Dann kann es also gar nicht gesund sein die guten Fette zu essen! Dann wäre es immer schädlich Fette zu essen. Und das kann ja gar nicht sein! Da stellt sich dann natürlich die Frage, warum die Pharmaindustrie immer darauf erpicht ist, LDL mit Medikamenten zu senken? Will da jemand vielleicht einfach nur viel Geld verdienen? Naja, aber dazu später mehr. Das Hauptproblem ist einfach nur, wenn das LDL-Paket durch oxidativen Stress (Oxidationsprozesse durch freie Radikale) im Körper zersetzt wird, dann aufplatzt, durch Makrophagen (Fresszellen) zerstört wird, diese ebenfalls aufplatzen und somit insgesamt ein klebriger Brei entsteht, welcher dann die Arterien verengt und es dann zur einer Thrombose kommt! Lesen Sie dazu noch einmal den Abschnitt "Wie eine Gefäßverengung entsteht" ganz am Ende meines ersten Teils zu diesen Thema "Was sind Fette?".
Und dann gibt es noch den Umstand, dass das der Körper es aus irgendeinen Grund nicht schafft, das LDL mittels HDL im richtigen Maß abzubauen, bzw. zurück zur Leber zu bringen. Somit bleibt dann mehr LDL im Körper als normal sein soll. Es geht hier also um das Verhältnis zwischen HDL und LDL - wie ich im ersten Teil auch schon erwähnt habe. Dieses Verhältnis errechnet man aus dem Quotienten von LDL und HDL. Dieser sollte kleiner als 3,0 sein. Man sagt, ein ungünstiger Wert liegt zwischen 3,0 und 5,0 vor.
Wenn also der HDL-Spiegel zu niedrig ist und der LDL dafür umso höher, ist das ein Hinweis darauf, dass der Körper irgendwo ein Problem mit dem Abbau von Cholesterin hat. Es kann sich hier - bei dauerhaften zu niedrigen HDL - um eine Fettstoffwechselstörung handeln. Aber auch Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel kann den HDL-Wert negativ beeinflussen.
Kann das Cholesterin nicht abgebaut werden - oder nicht im richtigen Maß - kann es auch Probleme mit den Gefäßen geben, bzw. kann es auch zu Ablagerung von Cholesterin an den Gefäßen kommen. Die Frage ist aber auch hier wieder: Ist es nur so, weil viel LDL noch im Körper kreist, oder ist die Gefahr von Herz-Kreislaufprobleme deswegen höher, weil durch mehr LDL-Cholesterin eine größere Angriffsfläche für Oxidationsprozesse vorherrscht?
Aber vielleicht kann es auch sein, dass - wenn wirklich viel zu viel LDL im Körper verbleibt - das Cholesterin dann vielleicht doch mal hier und da "stecken bleibt" und die Gefäße verengt. In erster Linie aber, sind es die Oxidationsprozesse die für Gefahr sorgen.
Weitere Ursache eines zu niedrigeren HDL-Spiegel können sein: Diverse Erkrankungen wie Diabetes, Leberinsuffizienz, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Krebs, seltene Erbkrankheiten wie Tangier-Krankheit; aber auch verschiedene Medikamente wie Betablocker (Herz-Kreislauf-Mittel) und Diuretika (entwässernde Medikamente).
Sie sehen also - solange man gute Fette isst, kann der Körper mit den Cholesterin gut umgehen. Man sollte eben auch auf den oxidativen Stress achten und gesund leben.
Doch was ist jetzt mit den Cholesterin aus den tierischen Lebensmittel?
Was anderes ist es, wenn man "fertiges Cholesterin" aus tierischer Nahrung isst, und man dadurch den Spiegel im Körper erhöht. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Körper so viel Cholesterin bildet wie er für die Fettverdauung BENÖTIGT. Wenn Sie aber sowohl Fette als auch noch fertig hergestelltes Cholesterin mit in den Körper bringen, dann ist der Körper erst einmal ein wenig irritiert, da er das ja eigentlich nur DANN benötigt wenn er die Fette verdaut. Somit haben Sie also ein Ungleichgewicht im Körper! Natürlich behilft sich der Körper jetzt damit, dass er dann weniger Cholesterin selber herstellt um die Fette zu verdauen, weil ja schon Cholesterin da ist - also zusammen mit den Nahrung im Körper gelangt ist.
Der Grund warum nur in tierischen Produkten von Natur aus Cholesterin drin ist, ist ja klar. Denn die Tiere haben ja auch fettige Lebensmittel gegessen, bzw. deren Stoffwechsel läuft auch mit einer Fettverdauung, wofür sie auch Cholesterin benötigen. Ob jetzt bei allen Tieren der Stoffwechsel genau so funktioniert wie bei uns, weiß ich jetzt nicht. Aber dennoch stellt der Körper von den Tieren, die hier gegessen werden, auch Cholesterin her und verdaut Fette. Tja und wenn dann die Tiere getötet werden um sie essen zu können, dann verbleibt natürlich hier und da Cholesterin im Fleisch, bzw. sie bilden es ja genauso ständig wie wir auch, da Cholesterin auch für andere Dinge benötigt wird. Denn dieser Stoff kommt auch in Zellmembranen vor. Es erhöht die Stabilität der Membran und trägt gemeinsam mit Proteinen dazu bei, Signalstoffe in die Zellmembran einzuschleusen und wieder hinaus zu befördern. Weiterhin ist es unverzichtbar für viele Stoffwechselprozesse, beispielsweise für die Bildung von Hormonen. Es ist also immer Cholesterin in Körper. Bei den Tieren und bei uns. Wenn auch nur, um Hormone herzustellen oder für die Zellmembranen - also auch dann wenn kein Fett gegessen wird.
Und damit ist auch klar, dass die Ausscheidungen der Tiere - welche die Menschen essen - also Milch (nicht den Kot, die Milch natürlich :-) ) - ebenfalls Cholesterin enthält.
Die wohl bekanntesten Beispiele für Produkte mit einem hohen Cholesteringehalt sind Butter und Eier. Beide gehören tatsächlich zu den cholesterinreichen Lebensmitteln: In 100 Gramm Ei stecken etwa 396 Milligramm Cholesterin, in der gleichen Menge Butter 230 Milligramm.
Aber auch Innereien wie Leber und Niere, fettes Fleisch, Wurstwaren und sogar manchen Fischsorten enthalten sehr hohe Mengen an Cholesterin. Räucheraal beispielsweise ist mit 149 Milligramm pro 100 Gramm cholesterinhaltig. Auch Kabeljau und Forelle enthalten Cholesterin. In Milchprodukten wie Vollmilch oder Käse kann es sich ebenfalls verstecken. So kommen 100 Gramm Camembert auf 112 Milligramm Cholesterin. Aber auch fettreiche Soßen (Sahnesoßen) und Dressings (zum Beispiel mit Mayonnaise) enthalten viel Cholesterin. Versteckte Fette finden sich zudem in Fertigprodukten, gesüßten Obstkonserven, Sirup und Eiscreme.
Und jetzt ist die Frage, ob es wirklich gut ist, fertiges Cholesterin zu essen.
Ja, es ist zwar immer Cholesterin im Körper, aber wenn Fette verdaut werden, dann wird noch zusätzliches Cholesterin gebildet, welches durch den Blutkreislauf geht - und zwar in einem optimalen Verhältnis. Doch das ändert sich ja, wenn von außen durch Essen von Tierprodukte dieses Verhältnis durcheinander gebracht wird.
Wie Sie ja wissen und gerade gelesen haben, haben Eier den höchsten Cholesterin-Gehalt. Und jetzt ist es so, dass der Körper eine maximale Grenze hat, wieviel Cholesterin er von außen aufnehmen kann. Dieses Maximum liegt bei um die 400 mg/dl. Wenn man also 2 Eier (Ein Ei hat ca. 250 mlg) isst - und man mit einem Cholesterinwert von (theoretisch) 0 anfängt - dann hat man schon die Maximale Aufnahmefähigkeit von Cholesterin leicht überstiegen. Mehr kann der Körper nicht mehr aufnehmen!
Das bedeutet: Ja, wenn Sie jetzt noch mehr Eier essen, dann wird Ihr Cholesterinspiegel nicht weiter steigen - oder nur ganz ganz wenig. Logisch, oder?
WEIL der KÖRPER NICHT MEHR AUFNEHMEN KANN!
DAS ist der wahre Grund warum "viel Eier essen" den Cholesterinspiegel nicht mehr hoch ansteigen lässt!
Verstehen Sie?
Mit anderen Worten: Der Grund ist NICHT, weil der Körper irgendwie es geschafft hat diese gewaltige Menge abzuarbeiten oder irgendsowas in der Art. Auch nicht, weil Cholesterin aus Eiern oder sonstigen tierischen Produkten völlig unbeachtet vom Körper einfach so durchgefallen lassen wird.
NEIN.
Der Körper ist überfordert!
Er will kein fertiges Cholesterin von außen mehr aufnehmen!
Weil es sonst zu gesundheitlichen Schäden kommen kann und wohl auch aus Kapazitätsgründen!
Bei der Studien, die damals gemacht wurden und das Ergebnis heraus gekommen ist, dass "Eier den Cholesterinwert nicht erhöhen" hat man genau DAS gemacht! Also, die Teilnehmer haben vor Beginn der Studie bereits 2 Eier gegessen. Damit war klar das ihr Cholesterinwert nun auf Maximum ist. Dann hat man in der Studie den Eierkonsum erhöht auf 4 Eier pro Tag und den Cholesterinwert gemessen. Man stellte fest, der Wert ging nicht höher. In der zweiten Wochen hat man den Konsum auf 6 Eier erhöht und wieder den Cholesterinwert gemessen. Auch hier ist der Wert - logischerweise - nicht höher gegangen. Der Cholesterinspiegel ist ja bereits gesättigt. Deswegen ging der Wert ja nicht höher! Und so kann man mit solchen Studien zeigen, egal ob 2 Eier, 4 Eier, 6 Eier oder 20 Eier: Es gibt keine weitere Erhöhung des Cholesterinwertes. So hat man mit solchen Studien die Menschen in die Irre geführt. Die Aussage der Studie stimmt ja sogar. Es wurde halt nur verschwiegen, dass ab einem Maximalwert von 400 mg/dl sich so gut wie nichts mehr tun wird mit einer weiteren Erhöhung. Und so stellen sich dann die Professoren und Doktoren da hin und sprechen davon, dass Eier den Cholesterinspiegel nicht erhöhen würden.
Die Menschen da draußen verstehen das dann komplett falsch und essen munter "kiloweise" Eier und denken, alles wäre gut. Oder auch nicht!
Übrigens - nur so nebenbei - waren bei der Studie nur 8 Teilnehmer vorhanden. Und das allein ist ja auch schon ein kleines Problem, wenn man denn eine wirklich aussagekräftige Studie machen will. Dafür braucht es dann schon ein wenig mehr Menschen.
Soviel also zu den Eiern und Cholesterinspiegel. Und das bedeutet natürlich jetzt, dass das Essen von Eiern immer dafür sorgen wird, dass Sie einen hohen (bis maximalen) Cholesterinspiegel haben. Wenn Sie dann jetzt nicht gerade so gesund leben und viele Oxidationsprozesse im Körper haben, dann haben Sie natürlich auch eine größere Angriffsfläche für diese freien Radikale, die dann das Cholesterin oxidieren lassen. Und dadurch steigt dann die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bzw. für Gefäßerkrankungen und Herzprobleme - im schlimmsten Fall eben Herzinfarkt.
Also sollten Sie dafür sorgen, dass die auch viele gute Antioxidantien im Körper haben und gesunde Lebensmittel essen, die das Cholesterin im Körper teilweise abbauen können. Welche Lebensmittel das sind und wie die Ernährung aussieht, das behandeln wir aber im dritten Teil dieser Serie.
Nachdem wir jetzt also geklärt haben wie die Fette durch den Körper wandern, stellt sich jetzt die Frage, was der Körper mit den Fetten macht und wozu er diese benötigt?
Wozu benötigt der Körper die Fette?
Wie bereits im ersten Teil erwähnt gibt es ja essentielle und nicht-essentielle Fettsäuren. Die essentiellen Fettsäuren sind die, die der Körper nicht selber herstellen kann und somit über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Zur Erinnerung: Das hier sind die essentiellen Fette
- Linolsäure - Omega-6-Fettsäure
- ALA (Alpha-Linolensäure) - Omega-3-Fettsäure
- DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) - beide sind Omega-3-Fettsäuren
Die anderen Fette kann der Körper selber herstellen. Aber dennoch: Was macht er denn mit den Fetten - als auch mit den nicht-essentiellen Fetten?
Nun, diese werden für eine ganze Reihe von Funktionen benötigt. Wichtig sind sie vor allem für Gehirn, Herz und Augen. Doch dazu später mehr.
Eine Wichtige Sache ist auch, dass es sogenannte "fettlösliche Vitamine" gibt. Also Vitamine, die sich nur in Fett lösen und diese somit für den Körper bereit gestellt werden können. Das sind die folgenden Vitamine: Vitamin A, D, E und K.
Hier gibt es eine kleine Eselsbrücke, wie man sich diese Vitamine merken kann. Man sagt nämlich, dass es die sogenannten "EDEKA"-Vitamine sind. Also E, D (DE), K, A.
Doch gehen wir es mal der Reihe nach durch. Wie auch in Teil 1 fangen wir auch hier mit den kurzkettigen Fettsäuren an.
Wofür benötigt der Körper die kurzkettigen Fettsäuren?
Sie erinnern sich noch? Von Kurzkettigen Fettsäuren spricht man, wenn die Kette der Kohlenstoffatome höchsten 6 Atome betragen.
Die für den Menschen relevanten Fettsäuren sind ja diese hier:
- Essigsäure, Acetat (2 Kohlenstoffatome)
- Propionsäure, Propionat (3 Kohlenstoffatome)
- Buttersäure, Butyrat (4 Kohlenstoffatome)
Kurzkettige Fettsäuren werden im Darm von bestimmten Bakterien aus unverdaulichen Kohlenhydraten (Ballaststoffe und verdauungsresistente Stärke) von der Darmflora gebildet. In welchen Ausmaß dies geschieht, hängt dabei von unserer Ernährungsweise und der Zusammensetzung unserer Darmflora ab. Für unsere Gesundheit ist neben der Gesamtmenge an kurzkettigen Fettsäuren auch ein stabiles Verhältnis der Fettsäuren wichtig. Eine gesunde Darmflora bildet zu etwa 60 % Acetat (Essigsäure) und zu jeweils knapp 20 % Propionat (Propionsäure) und Butyrat (Buttersäure). Eine stark davon abweichende Verteilung kann auf eine Störung der Darmflora hinweisen.
Kurzkettige Fettsäuren wirken einerseits lokal im Darm und sind die Hauptnahrungsquelle für die Zellen des Dickdarms. Andererseits werden Sie aber auch über die Darmschleimhaut in den Körper aufgenommen und wirken so auf den gesamten Körper.
Die Begriffe Acetat, Propionat, Butyrat bezeichnen die entsprechenden Anionen. Ein Anion ist ein negativ geladenes Ion, also ein Atom oder Molekül, das mehr negativ geladene Elektronen als positiv geladene Protonen besitzt. So liegen Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure im Darm bzw. in wässriger Umgebung nicht als Säure vor, sondern als das entsprechende Anion. Das bedeutet, dass sie ein Proton abgegeben haben und nun eine negative Ladung tragen. Die Fettsäure-Anionen sind im Wasser bzw. im Darminhalt gelöst.
Bei Nahrungsergänzungen, die kurzkettigen Fettsäure enthalten, enthalten weder die Säuren noch die Anionen in wässriger Umgebung. Stattdessen handelt es sich um Kapseln, die ein Pulver enthalten. Dieses Pulver entsteht, wenn man die Fettsäure-Anionen mit Natrium-Ionen oder anderen Metall-Ionen zu einem Salz auskristallisieren lässt. Aus Buttersäure oder Propionsäure wird dann z. B. Natriumbutyrat bzw. Natriumpropionat - und genau diese Verbindungen sind dann in Ihren Kapseln enthalten. Wenn Sie die Kapseln schlucken (oder in ein Glas Wasser geben), dann löst sich das Pulver wieder auf, sodass die Fettsäure-Anionen und die Natrium-Ionen wieder separat vorliegen. Genau das gleiche passiert übrigens, wenn Sie ein anderes Salz in Wasser geben. Beim Auflösen von Speisesalz (Natriumchlorid) liegen schließlich Natrium- und Chlorid-Ionen separat in Lösung vor.
So wirken kurzkettige Fettsäuren
--> Ernährung der Darmzellen
Kurzkettige Fettsäuren sind eine wichtige Energiequelle für die Epithelzellen der Dickdarmschleimhaut. Insbesondere Butyrat (Buttersäure) ist von großer Bedeutung, da es etwa 70 % des Energiebedarfs der Darmzellen deckt- Eine ausreichende Energieversorgung der Darmzellen ist wichtig für deren Funktionsfähigkeit und Vitalität. Ein Energiemangel schwächt z. B. die Darmbarriere und stört die Aufnahme von Nährstoffen aus dem Darminhalt.
--> Schutz der Darmbarriere
Die Zellmembranen benachbarter Darmzellen sind durch spezielle Verschlusskontakte (sogenannte Tight Junctions) eng miteinander verbunden. Diese verhindern, dass schädliche Substanzen zwischen den Zellen hindurch gleiten und in den Blutkreislauf gelangen.
Bei entzündlichen Reaktionen in der Darmschleimhaut kommt es zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere. Dies liegt unter anderem an einer verstärkten Bildung eines porenbildenden Proteins (wird Claudin-2 genannt). Dieses Protein bildet Poren im Bereich der Tight Junctions und stört somit deren Barrierefunktion.
Butyrat kann die übermäßige Bildung dieses Proteines regulieren und fördert zudem die Bildung von Proteinen, die für den Bau der Tight Junctions erforderlich sind. Butyrat kann also eine durchlässige Darmbarriere wieder dichter machen.
Zudem fördert Butyrat auch die Bildung der Schleimschicht im Darm, die wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern ist. Weiterhin reduziert Butyrat die Auswirkungen von oxidativem Stress auf die Darmzellen, indem es u. a. die verfügbare Menge an Glutathion, einem wichtigen körpereigenen Antioxidans, erhöht.
Aber auch andere kurzkettige Fettsäuren schützen vor dem Eindringen von Infektionserregern bzw. vor einer Vermehrung von schädlichen Keimen im Darmlumen. So schützt beispielsweise Propionat vor einer Infektion mit Salmonellen, indem es den pH-Wert innerhalb der Bakterien senkt und dadurch deren Vermehrung verlangsamt.
--> Positiver Einfluss auf Darmflora
Die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren senkt den pH-Wert im Dickdarm und fördert dadurch die Vermehrung von gesundheitsförderlichen Darmbakterien wie Laktobazillen und Bifidobakterien. Diese Bakterien sind wiederum entscheidend für die Bildung der kurzkettigen Fettsäuren.
--> Wirkung gegen chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Colitis ulcerosa und Morbus Crohn sind die beiden Hauptformen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Studien zeigen, dass Nahrungsergänzungen mit kurzkettigen Fettsäuren das Ausmaß der Entzündungen im Darm reduzieren können. Insbesondere für Butyrat wurde ein erfolgreicher Einsatz bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gezeigt.
--> Regulierung des Körpergewichts
Kurzkettige Fettsäuren versorgen nicht nur die Darmzellen, sondern auch den restlichen Körper mit Energie. Sie decken etwa 10 % des täglichen Kalorienbedarfs. Auch sind sie am Stoffwechsel wichtiger Nährstoffe wie Kohlenhydrate und Fette beteiligt und beeinflussen als Signalmoleküle den Energiestoffwechsel. Studien haben gezeigt, dass es spezielle Rezeptoren (z. B. GPR41, GPR43) für kurzkettige Fettsäuren im Körper von Säugetieren gibt. Diese Rezeptoren kommen auf den Zellen des Darmepithels vor, aber auch auf Fettzellen, verschiedenen Immunzellen und Nervenzellen.
Binden kurzkettige Fettsäuren innerhalb des Fettgewebes an diese Rezeptoren, so kann dies u. a. dazu führen, dass die Fettverbrennung gesteigert wird und die Fettspeicherung verringert wird. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass kurzkettige Fettsäuren die Ausschüttung von Sättigungshormonen wie Leptin erhöhen und dadurch die Nahrungsaufnahme reduzieren.
Forscher vermuten, dass diese Wirkungen dazu beitragen, dass kurzkettige Fettsäuren der Entstehung von Übergewicht und metabolischen Erkrankungen entgegenwirken, auch wenn sie dem Körper zusätzliche Kalorien liefern.
--> Wirkung gegen Diabetes Typ II
Sowohl Tierstudien als auch Humanstudien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Diabetes Typ 2 und einer Störung der Darmflora. Die mangelnde Produktion an kurzkettigen Fettsäuren durch die gestörte Darmflora scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen.
Wesentliche Merkmale von Diabetes Typ 2 sind eine zunehmende Insulinresistenz der Gewebe, ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel und chronische Entzündungsvorgänge im Körper.
Untersuchungen zeigen, dass kurzkettige Fettsäuren dazu beitragen können, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und die Insulinsensitivität bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern.
Die Insulinsensitivität der Probanden verbesserte sich deutlich im Verlauf der Studie und die Marker für systemische Entzündungen gingen zurück.
Andere Humanstudien haben ebenfalls Zusammenhänge zwischen fermentierbaren Ballaststoffen wie Inulin und einer verbesserten Blutzuckerkontrolle und Insulinempfindlichkeit beschrieben.
--> Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Zahlreiche Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass kurzkettige Fettsäuren den Cholesterinspiegel senken können, indem sie u. a. die körpereigene Cholesterinproduktion reduzieren und den Abbau und die Ausscheidung von Cholesterin fördern.
In einer Studie an Mäusen, die eine fettreiche Fütterung erhielten, konnte weiterhin nachgewiesen werden, dass Butyrat vor der Entstehung von Arteriosklerose und einer Fettleber schützt.
Weiterhin konnte auch gezeigt werden, dass Butyrat die Entstehung der Schaumzellen (geplatze Magorphagen) verhindert und reduziert somit auch die Ausbildung arteriosklerotischer Plaques. Dadurch sinkt u. a. das Risiko für Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
Für Propionat und Butyrat wurde außerdem gezeigt, dass sie den Blutdruck senken können und das Risiko für die Entstehung von Thrombosen minimieren.
--> Antientzündliche Wirkung und Einfluss auf Immunzellen
Kurzkettige Fettsäuren beeinflussen das Immunsystem auf vielfältige Weise. Wie in den vorigen Abschnitten erklärt, befinden sich spezielle Rezeptoren für kurzkettige Fettsäuren auf der Oberfläche verschiedener Immunzellen.
Binden die Fettsäuren an den entsprechenden Rezeptor, so kommt es zu einer Beeinflussung der Genaktivität der Immunzellen, wodurch bestimmte Zellfunktionen ausgelöst werden.
Zahlreiche Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass kurzkettige Fettsäuren eine entzündungshemmende Wirkung haben, indem sie die Bildung von entzündungshemmenden Zellbotenstoffen steigern und dadurch das Ausmaß von Entzündungsvorgängen im Körper reduzieren.
Besonders interessant ist auch die Entdeckung, dass Propionat und Butyrat die Bildung von regulatorischen T-Zellen stimulieren. Regulatorische T-Zellen sind spezielle Immunzellen, die die Selbsttoleranz des Immunsystems regulieren und damit das Risiko für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen und Allergien senken. Außerdem regulieren sie die Stärke von Immunreaktionen und sind wichtig, um Entzündungsvorgänge zu beenden.
Ein gesundes Mikrobiom ist demnach von größter Relevanz für die korrekte Funktion unseres Immunsystems.
--> Wirkung gegen Krebs
Kurzkettige Fettsäuren könnten eine wichtige Funktion bei der Vorbeugung und Behandlung bestimmter Krebsarten haben - vor allem bei Dickdarmkrebs.
Labor- und Tierstudien zeigen, dass Butyrat dazu beiträgt, Dickdarmzellen gesund zu halten, das Wachstum von Tumorzellen zu verhindern und die Zerstörung von Krebszellen im Dickdarm zu fördern.
--> Schutz des Nervensystems
Immer mehr Studien belegen, dass die Gesundheit unseres Darms eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Erkrankungen wie Parkinson, Demenz oder Multipler Sklerose (MS) spielt. Die im Darm gebildeten kurzkettigen Fettsäuren sind dabei ein zentrales Bindeglied zwischen der Darmflora und dem Nervensystem.
Studien am Menschen konnten z. B. nachweisen, dass bei MS-Patienten im Blut und Stuhl ein Mangel an Propionat vorliegt. Die Einnahme von Propionat als Nahrungsergänzung erhöht u. a. die Menge an entzündungshemmenden Immunzellen (regulatorischen T-Zellen) und kann dadurch die Entzündungsvorgänge im Nervensystem deutlich reduzieren.
MS-Patienten, die 1000 mg Propionat pro Tag einnahmen in Kombinationen zu ihrer bestehenden Therapie, hatten in einer Studie weniger Krankheitsschübe als Patienten, die kein Propionat einnahmen. Im MRT konnte sogar festgestellt werden, dass die Propionateinnahme zur Bildung von neuem Hirngewebe führt und damit zu einer Regeneration des Nervengewebes.
Verbesserungen (z. B. höhere Konzentration an entzündungshemmenden Immunzellen und geringere Konzentrationen an entzündungsfördernden Zellen) konnten bereits nach 2 Wochen festgestellt werden. Die Patienten wurden noch über einen Zeitraum von 3 Jahren nachverfolgt. Die Studie umfasste etwa 100 Teilnehmer
Andere Studien zeigten außerdem, dass kurzkettige Fettsäuren die Blut-Hirn-Schranke schützen und der Entstehung von Alzheimer) und Parkinson entgegen wirken.
Sie sehen also, die kurzkettigen Fettsäuren haben schon viele wichtige Funktionen für unseren Körper - vor allem für unsere Verdauung und für den Darm sind sie sehr wichtig. An dieser Stelle sollte ich vielleicht fairerweise darauf hinweise, dass ich diesen ganzen Absatz "Wirkung von kurzkettigen Fettsäuren" mehr oder weniger (mit etwas Abänderung") von der Seite "www.zentrum-der-gesundheit.de" übernommen habe. Denn die Autoren haben die Informationen dazu sehr gut zusammengetragen.
Der genau Artikel dazu ist dieser hier:
Kurzkettige Fettsäuren - ZDG
Dort finden Sie noch weitere Informationen zu kurzkettigen Fettsäuren und auch die Links zu den erwähnten Studien!
Ob Sie nun also genug kurzkettigen Fettsäuren im Körper haben, kommt natürlich wieder auf ihre Lebens- und Ernährungsweise an. Denn dazu müssen ja die richtigen Mengen an Bakterien im Darm vorhanden sein, die ja durch schlechte Ernährung mit viel Zucker und Alkohol, stark verarbeitete Fertignahrung, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung und zu wenig gute Ballaststoffe leiden werden, bzw. in ihrer Anzahl reduziert werden.
Deshalb essen Sie ausreichend fermentierbare Ballaststoffe, die ja als Ausgangsstoff für die Bildung von Fettsäuren dienen. Achten Sie auf eine gesunde Ernährung, damit der ph-Wert im Darm bei ca. 5,8 und 6,5 bleibt. Denn durch zuviele schädliche Säuren aus Zucker und Alkohol und so weiter, kann der ph-Wert zeitweise abrutschen und das Überleben der Bakterien in Gefahr bringen.
Meiden Sie so gut es geht schädliche Stoffe aus den Nahrung. Da kann man wieder unendlich viel Aufzählen.. ich denke Sie wissen ungefähr was gemeint ist. Chemie, Petizide, schädliche Konservierungstoffe.. und so weiter.
Aber auch ein zu hoher Gehalt an Proteinen und Eiweiß sollte es auch nicht dauerhaft sein. Denn auch dadurch kann die Darmflora negativ beeinflusst werden. Auf der Seite von ZDG ist auch auf eine Studie hingewiesen worden, die gezeigt hat, dass bei gesunde menschliche Probanden, deren Kalorienbedarf über einen Zeitraum von 6 Monaten entweder zu 20 %, 30 % oder 40 % über Fett gedeckt wurde, mit steigendem Fettgehalt die Zahl der nützlichen Bakterienarten im Darm abnimmt und die Menge an produzierten kurzkettigen Fettsäuren sinkt. Gleichzeitig nimmt die Menge an potentiell schädlichen Darmkeimen zu und Entzündungsmarker im Blut steigten an.
So, und hier noch einmal eine Liste der präbiotischen Lebensmittel, die für die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren wichtig sind. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich darüber auch im der Kohlenhydrate-Serie gesprochen habe. Gut, aber zur Auffrischung des Gedächtnisses, hier noch einmal - bitte sehr:
Präbiotische Lebensmittel
- Inulin: z. B. in Schwarzwurzeln, Yakonwurzeln, Artischocken, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, Spargel
- Fructooligosaccharide (FOS): z. B. in Artischocken, Chicorée, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch und Spargel
- Resistente Stärke: z. B. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln
- Pektin: z. B. in Äpfeln, Aprikosen, Karotten, Orangen, Schale von Zitrusfrüchten
- Arabinoxylan: in der Schale von Getreidekörnern, z. B. in Haferkleie
- Guarkernmehl: wird aus der Guarbohne, einer Hülsenfrucht, gewonnen
- Beta-Glucan: z. B. in Hafer ( 47 )
Nahrungsergänzungen mit kurzkettigen Fettsäuren
Wie gesagt, gibt es auch frei verkäufliche Nahrungsergänzungen für diese Fettsäuren. Die Einnahme sollte jedoch idealerweise erst nach einer Darmuntersuchung (Mikrobiomanalyse, Stuhl- oder Blutuntersuchung hinsichtlich Fettsäure-Produktion) erfolgen.
In Studien hat sich gezeigt, dass diese durchaus helfen können. Die Einnahme ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine Dysbiose (Darmflorastörung) vorliegt und dem Körper somit die vielfältigen positiven Wirkungen der kurzkettigen Fettsäuren nicht zur Verfügung stehen. Dadurch kann sich der Darmfloare wieder schneller regenerieren. Langfristig sollte natürlich auch wieder daran gearbeitet werden, dass die Eigensynthese des Körpers wiederhergestellt werden kann.
So, soviel also zu den kurzkettigen Fettsäuren. Jetzt wissen Sie was der Körper damit macht und wofür in etwa er diese benötigt. Nun geht es weiter mit den mittelkettigen Fettsäuren.
Wofür benötigt der Körper die Mittelkettigen Fettsäuren?
Mittelkettige Fettsäuren (MCT-Fette) sind in natürlicher Form nur in Palmkernöl, Kokosöl und in geringem Maß in Milchfett zu finden.
Wie im ersten Teil dieser Serie schon gesagt, spricht man von mittelkettigen Fettsäuren, wenn die Fettsäure eine Kette zwischen 6 und 12 C-Atome hat.
Hierzu zählen die
- bereits genannte Caprylsäure (mit 8 C-Atome),
- die Caprinsäure (mit 10 C-Atome)
- und auch die Laurinsäure (mit 12 C-Atome).
Diese Fettsäuren sind gesättigt und kommen in der Natur nicht in reiner Form vor. Vielmehr handelt es sich um Gemische mit langkettigen Fettsäuren.
MCT-Fette sind leichter verdaulich als Langkettige Fette und deshalb für Menschen mit Darmleiden, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und Galle sowie Fettabsorptionsstörungen besser verträglich. Aber auch, wenn ein Teil des Dünndarms entfernt wurde, bei Morbus Crohn oder bei einer Blockade des Lymphabflusses aus dem Darm helfen MCTs,
Denn diese Fette sind ja - wie weiter oben bereits gesagt - wesentlich besser in Wasser löslich als die langkettigen Fettsäuren. Folglich sind zur Verdauung der MCTs lediglich minimale Mengen an Enzymen aus der Bauchspeicheldrüse (die Lipasen) und eben keine Gallensäuren notwendig. Die MCTs werden im Magen-Darm-Trakt schnell gespalten und leicht aufgenommen. Deshalb benutzt der Körper diese Fette weniger zur Speicherung, sondern zur Energiegewinnung. Bei der Verstoffwechselung von MCT-Fetten in der Leber entstehen sogenannte "Keton-Körper", die als alternative Energiequelle für das Gehirn und andere Organe dienen können.
Zu den so genannten Ketonkörpern gehören chemischen Verbindungen wie Acetoacetat, Aceton und Beta-Hydroxybutyrat. Ketonkörper entstehen bei absolutem oder relativem Kohlenhydratmangel als Nebenprodukt der Fettverbrennung in den Mitochondrien der Leberzellen. Auf dieser Weise soll eine Diät, bestehend zum Großteil nur aus MCTs beim Abnehmen helfen.
Aber ist das wirklich so?
Eine erhöhte Konzentration an Ketonkörpern im Blut wird unter anderem für ein vermindertes Hungergefühl verantwortlich gemacht. Außerdem können sie dem Gehirn als Energielieferant dienen, wenn dem Körper mit der Nahrung weniger Kalorien zugeführt werden, als er braucht. Ansonsten würde der Organismus nämlich Muskeleiweiß abbauen, um daraus Glucose als Energielieferant bilden zu können.
MCT-Fette sollen die Ketose, also die Umstellung des Stoffwechsels auf die Energiegewinnung aus Fetten statt Kohlenhydraten, beschleunigen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hält die mittelkettigen Triglyceride allerdings für nicht empfehlenswert, um abzunehmen. Grund: Es fehlen Langzeitstudien bezüglich Nutzen und Verträglichkeit der MCT. Darüber hinaus sind sie in der Küche nur sehr begrenzt einsetzbar, da sie nicht hoch erhitzbar sind und durch Warmhalten einen bitteren Geschmack entwickeln.
Gut, es gibt aber viele Leute, die diese sogenannte "Ketogene Ernährung" seit einiger Zeit machen und von Vorteilen sprechen.
Da MCT-Fette dem Körper schneller Energie liefern als langkettige, sollen vor allem auch Ausdauersportler davon profitieren. Bei langen Trainingseinheiten und Wettkämpfen droht der berüchtigte Hungerast - bei Marathons als "Mann mit dem Hammer" gefürchtet. Sind die Glykogenspeicher geleert, holt sich der Körper die Energie aus den Fettzellen. Wurde diese Umstellung nicht ausreichend trainiert, sinkt die Leistungsfähigkeit rapide. Die Zufuhr von MCT-Fetten soll das verhindern. Viele Athleten vertrugen allerdings die mittelkettigen Fettsäuren nicht so gut und reagierten mit Durchfall und Magenbeschwerden auf sie - da übrigens generell fettreiche Lebensmittel unter Belastung sehr schwer verdaulich sind.
Natürlich muss man erst einmal die Umstellungsphase des Körper überstehen. Denn hier kann es kurzzeitig zu Unwohlsein kommen. Wichtig zu wissen: Um in die sogenannte "Ketose" zu kommen darf man nicht mehr wie 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu sich nehmen.
Nimmt man vermehrt Fette zu sich, muss der Körper zunächst eine höhere Zahl der Enzyme bilden, die das Fett abbauen können, um dann in die Ketose zu gelangen. Dieser Umstellungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Wie lange genau diese Umstellungsphase dauern kann, ist von Person zu Person verschieden. Erfahrungsberichte reichen von wenigen Tagen, bis hin zu mehreren Wochen. Manchmal kann es dabei zu der so genannten "Low-Carb-Grippe" kommen. Magen- und Kopfschmerzen, sowie ein vorübergehender schwacher Kreislauf durch niedrigen Blutzucker können die Symptome sein. In dieser Zeit hilft es den Kreislauf bei der Umstellung durch viel Trinken (mind. 2,5 Liter) zu unterstützen.
Um in die Ketose zu kommen muss man neben einen geringen Anteil an Kohlenhydraten, einen hohen Anteil von gesunden Fetten zu sich nehmen. Studien empfehlen Mengen von 60 bis 80%. Der Trick besteht dabei darin, die richtigen und gesunden Fette wie Kokosöl, Olivenöl oder das spezielle MCT-Öl zu verwenden.
Bei der MCT-Diät werden Kokosöl oder Palmkernöl verwendet. Diese kann man zum Kochen, Backen, Braten verwenden oder etwas davon in einem Smoothies geben. Weiterhin gibt es spezielle Produkte, also bestimmte Öle, die einen größeren Anteil an MCT-Fette enthalten. Auch gibt es Öle, die zu 100 Prozent aus reiner Caprylsäure (C8) bestehen. Dazu wurde dieses Fett natürlich aus z.B. Kokoöl extrahiert. Denn wie schon gesagt, in isolierter Form gibt es diese Fette so in der Natur nicht. Jedenfalls kann man sich dieses geschmacksneutrale Fett in Kaffee mischen, um somit volle Fett-Energie erhalten zu können. Auch gibt es Pulver, die man in Müsli oder Shakes einrühren kann. Gerade das Gehirn soll auch von diesen MCT-Fetten viel Leistung erhalten.
Darüber hinaus sollten Eier und große Mengen Gemüse auf dem Speiseplan stehen, um ausreichende Mengen an Protein und Vitaminen aufzunehmen. Gute Powerlieferanten - wie sie in der Ketogene Ernährung genannt werden - sind Avocados, Nüsse und Fisch.
Wen man jedoch viel unterwegs ist, kann sich diese Ernährungsform etwas schwierig gestalten. Doch wenn Sie genaueres zu dieser Ernährung wissen wollen, dann suchen Sie im Internet nach "Ketogene Ernährung". Eine Internetseite, die sich auch damit befasst, ist dieser hier:
Leistungsfähige durch Ketose - brain-effect.com
Es ist auch nicht wirklich klar, ob die Ketogene Ernährung eine Ernährung ist, die man dauerhaft (mehrere Monate oder länger) machen sollte. Vorübergehend für eine gewisse Zeit mag es vielleicht hilfreich sein um etwas an die Gesundheit zu verbessern. Jedoch aber imitiert die Ketogene Ernährung den Fasten-Zustand. Und ja, Fasten ist gut, aber "für immer" sollte man das auch nicht machen. Es gibt zwar einige Studien dazu, die ein paar Menschen über einen längeren Zeitraum beobachtet haben, aber waren dies immer nur einzelne oder wenige Leute. Naja, das muss jeder für sich wissen, aber "für immer" auf Ketogen zu laufen ist sicherlich auch nicht das Beste. Der Körper sollte nicht verlernen Kohlenhydrate zu verdauen - zumal der Körper für einige Stoffelwechselvorgänge auch Kohlenhydrate benötigt - z.B. benötigt er für die Herstellung der sogenannten Mucus-Schicht (Schmiermittel für den Darm) Kohlenhydrate und Proteine.
Aber vielleicht noch so nebenbei erwähnt: Sie müssen keine tierischen Produkte essen, wenn Sie die Ketogene Ernährung machen wollen. Denn diese Ernährungsform funktioniert auch vegan! Ja tatsächlich! Hier eine Internetseite, wo diese Ernährungsform vegan beschrieben wird::
Ketogene Ernährung vegan - bitterliebe.com
Also - noch einmal zusammengefasst:
Was sind die Vorteile von mittelkettigen Fettsäuren?
Positiv an den mittelkettigen Fetten ist, dass sie im Gegensatz zu langkettigen gesättigten Fettsäuren den Cholesterinspiegel im Blut nicht erhöhen.
Für den Einsatz von MCTs in Reduktionsdiäten spricht auch, dass sie mit durchschnittlich etwa acht Kilokalorien pro Gramm etwas weniger Energie enthalten als langkettige Fette (9 kcal/g). Bei ihrer Verstoffwechselung werden neun Prozent der Energie als Wärme frei, bei langkettigen Fetten nur drei. Da der so genannte thermogene Effekt bei MCTs also größer ist, steht weniger Energie zur Bildung von überflüssigen Pfunden zur Verfügung. Studien mit Übergewichtigen Menschen sollen wohl auch gezeigt haben, dass bei energiereduzierter Kost die Versuchsgruppe mit MCT mehr Gewicht verlor und länger satt war als die Gruppe, die normale Fette verzehrte. Der proteinsparende Effekt durch die vermehrte Bildung von Ketonkörpern wurde ebenfalls bestätigt. Der Anteil des Körperfetts am Gewichtsverlust war bei MCT-Gabe größer und die Verluste an Muskeleiweiß geringer. Jedoch bestanden die Vorteile nur in den ersten zwei Wochen des Untersuchungszeitraums. Danach ließen die Wirkungen langsam, aber deutlich nach. Als Ursache dafür vermuten die Forscher, dass sich der Stoffwechsel an die veränderten Bedingungen anpasst.
Quelle: MCT-Fette - ugb.de
Ersetzt man am Tag 50 Gramm langkettige Fette gegen MCTs, bringt das eine Einsparung von 50 Kilokalorien. Durch die größere thermogene Wirkung der MCTs kommt man auf etwa 80 Kilokalorien täglich. Eine Aufnahme von deutlich mehr als 50 Gramm MCTs ist nicht realistisch. Die Aufnahme von zu vielen MCTs und damit zu viele Kalorien kann auf Dauer auch zu Übergewicht führen. Auch ist es so, dass es bisher nur Öl, Margarine, Mayonnaise, Schmelzkäse, süße und herzhafte Brotaufstriche sowie Energieriegel mit MCTs gibt. Denn wie weiter oben schon gesagt, kommen MCTs in der Natur nur in Kombinationen mit Langkettigen Fettsäuren vor. Will man also nur MCts (oder zum Großteil) aufnehmen, dann muss man schon darauf achten, speziell hergestellte Produkte zu verwenden, die extrahierte MCTs enthalten. Natürlich dürfen die anderen Fettsäuren auch nicht fehlen, deswegen isst man ja auch ganze Lebensmittel wie Nüsse, Avocados und so weiter.
Hat man also wirklich eine längere Ausdauer mit MCT-Fette?
Während sportlicher Belastungen über mehrere Stunden sind Ausdauersportler auf die Zufuhr von Nahrungsenergie angewiesen. Normalerweise nehmen sie viele Kohlenhydrate auf, um den Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten und die Ausdauer zu verbessern. Jedoch ist der Beitrag zur Energiegewinnung begrenzt. Mehr als 1,1 Gramm der zugeführten Kohlenhydrate kann der Körper pro Minute nicht zur Energiegewinnung heranziehen. Um die Energiereserven in den Muskeln (Glykogenspeicher) zu schonen, kommen eben die MCTs zum Einsatz. Denn Eiweiße sind hier keine gute Idee, da bei ihrer Verbrennung Ammoniak anfällt, das vermutlich den Körper schneller ermüden lässt. Fette mit langkettigen Fettsäuren, wie sie in den meisten Lebensmitteln vorkommen, hemmen die Magenentleerung und verzögern damit die Aufnahme in den Körper. MCTs scheinen daher ideal zu sein, um bei langen Belastungen mit mittlerer Intensität größere Mengen an Energie zu liefern, die Glykogenspeicher dadurch zu schonen und den Abbau von Muskeleiweiß zur Energiegewinnung zu verhindern.
Doch auch hier gibt es ein paar Probleme.
Untersuchungen mit Ausdauersportlern zeigten, dass MCTs aus Getränken gut verfügbar und nutzbar sind, insbesondere wenn sie mit Kohlenhydraten gemeinsam verabreicht werden. Problematisch ist jedoch die schlechte Verträglichkeit der mittelkettigen Fette. Unter Belastung verursachen diese häufig Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu schweren Darmkrämpfen - und das schon bei einer Menge von 30 Gramm. Verträgliche Mengen MCTs schonen bei genauerer Betrachtung auch nicht immer die Glykogenreserven, sondern sparen eher Speicherfette ein. Denn bei Athleten, deren Glykogenspeicher völlig entleert waren, kam es zwar zu einem Anstieg der Gesamtfettverbrennung, der Anteil der MCTs blieb mit sechs bis acht Prozent aber gering. Die einzigen Möglichkeiten, um eine optimale Leistung bei mehrstündigen Ausdauerbelastungen zu gewährleisten, sind also nach wie vor ein durch lange Belastungen niedriger Intensität gut trainierter Fettstoffwechsel, maximal gefüllte Glykogenspeicher und eine regelmäßige Zufuhr gut verfügbarer Kohlenhydrate während der Belastung.
Und jetzt noch einmal zusammengefasst wo hier die Probleme liegen.
MCTs: Durchfall durch mittelkettige Fette
Da MCTs alleine in natürlichen Lebensmitteln ja kaum vorkommen, ist der menschliche Verdauungstrakt auch nicht an die Verwertung größerer Mengen mittelkettiger Fette gewöhnt. Er reagiert schnell mit Unverträglichkeitsreaktionen wie Bauchschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Wird die MCT-Zufuhr über mehrere Tage langsam gesteigert, kann sich der Organismus jedoch an verzehrsübliche Fettmengen in Form von MCTs gewöhnen. Allerdings leisten reine MCT-Produkte keinen Beitrag zur Versorgung mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Vitaminen. Einige Hersteller bieten deshalb inzwischen MCT-Produkte an, die mit fettlöslichen Vitaminen und Linol- sowie Alpha-Linolensäure angereichert sind und damit eine bessere ernährungsphysiologische Qualität aufweisen.
MCTs bringen in der Ernährungstherapie von Fettstoffwechselstörungen möglicherweise viele Vorteile. Jedoch muss man hier genau wissen was man tut, damit es nicht zu unerwünschten gesundheitlichen Problemen kommt. Deswegen ist es nicht so ratsam diese Ernährung über einen zu großen Zeitraum durchzuführen.
Weitere Funktionen der MCTs
Wie auch schon angedeutet, werden die Vitamine E, D, K, A eng zusammen mit den Fetten verdaut und verstoffwechselt. Deswegen können diese auch nicht so einfach über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden werden, wenn wir zu viel von ihnen aufnehmen.
Die fettlöslichen Vitamine werden reguliert, indem sie hauptsächlich in der Leber gespeichert werden. Diese Speichermöglichkeiten sind sehr ergiebig. Trotzdem aber sollten wir es nicht mit den Vitaminen übertreiben. Denn durch eine extrem hohe Zufuhr von fettlöslichen Vitaminen kann die Leber dennoch überfordert werden, was dann tatsächlich auch zu einer Vitaminvergiftung (Hypervitaminose) führen kann.
Keine Sorge, mit natürlichen Lebensmitteln lässt sich das aber kaum bewerkstelligen. Die einzige Ausnahme ist der sehr häufige bzw. tägliche Verzehr von Leberfleisch, weil die fettlöslichen Vitamine auch bei Tieren dort in sehr hoher Konzentration gespeichert werden. Daher sollte man Leber nicht mehr als zweimal die Woche essen. Eine weitere Möglichkeit zu viele von diesen Vitaminen einzunehmen ist natürlich über die unsachgemäße Einnahme von Vitaminpräparaten.
Was die Fettlöslichkeit angeht mit den Vitaminen, ist es dabei egal welches Fett dazu verwendet wird. Die Vitamine sind in Fett aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren, in einfach ungesättigten Fettsäuren und auch in gesättigten Fetten löslich.
Und damit habe ich nun das Stichwort "gesättigte Fette" genannt.
Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass gesättigte Fette ja angeblich so ungesund sein sollen. Gesättigte Fette sind ja die Fette, die eine vollständige Kette von C-Atomen haben und bei denen an jedes C-Atom in der Kette immer 2 H-Atome dran hängen.
Hier mal einige Beispiele für solche gesättigten Fettsäuren:
- Ameisensäure (kurzkettig)
- Essigsäure (kurzkettig)
- Buttersäure (kurzkettig)
- Propionsäure (kurzkettig)
- Caprylsäure (mittelkettig)
- Caprinsäure (mittelkettig)
- Palmitinsäure (Langkettig)
- Stearinsäure (langkettig)
Die Mittelkettigen Fettsäuren sind auch solche gesättigten Fette.
Sind gesättigte Fette wirklich so ungesund für das Herz-Kreislauf-System?
Nun, schauen wir uns dieses Thema mal etwas genauer an.
Der Grund warum gesättigte Fette so schädlich sein sollen ist der, weil gesättigte Fette den LDL-Cholesterin-Spiegel erhöhen. Und weil man ja in der Vergangenheit immer gesagt hat, das LDL sei ja so super böse und gefährlich und verursacht damit die Gefäßverengung, hat man angefangen zu erzählen, dass gesättigte Fette schädlich sind. Das ist schon alles. Daher kommt dieser Glaube. Doch wenn Sie meine Artikel bis hier her gelesen haben, dann wissen Sie ja jetzt das man die Angelegenheit mit den Cholesterinspiegel und den LDL etwas differenzierter betrachten muss. So einfach und plump wie man das in der Vergangenheit gesagt hat, ist es ja eben nicht. Und ganz ehrlich: Ich habe mich eh schon länger mal gefragt (wenn ich diese Aussagen mit den gesättigten Fetten gelesen habe), warum der Körper denn so ein Problem haben soll mit diesen Fetten, die eine vollständige Reihe von Kohlenstoffatomen haben? Ich mein, müsste man nicht eigentlich eher denken, das gerade diese vollständige Fette-Kette eigentlich eher gut für den Körper ist, weil er diese vielleicht "besser erkennen" kann, als eine Fettsäure, die irgendwo ein Lücke in der Kette hat? Ok, ich gebe zu, dass ist auch etwas kurz gedacht, aber dennoch fand ich das immer so komisch das diese perfekt ausbalancierte Kohlenstoffkette so ein Problem sein soll. Naja, gut, dann fand ich heraus, dass es um den Cholesterinspiegel geht. Und jetzt wird es interessant. Mal sehen ob sich diese Aussage bezüglich der gesättigten Fette wirklich halten kann.
Wie alles begann:
Es gab in der Vergangenheit viele Studien, die allesamt vor gesättigten Fettsäuren warnten und überhaupt erst zur der allgemeinen "Angst vor Fetten" führten. Doch konnten diese Studien häufig einer genaueren Überprüfung nicht standhalten. Besonders engagiert war einst der Wissenschafter "Ancel Keys", der die allgemeine Fett-Ablehnung immer weiter schürte, indem er ab den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein immer wieder zweifelhafte Studien veröffentlichte.
Dieser Wissenschaftler hat damals die sogenannte und bekannte "Sieben Länder-Studie" durchgeführt. Dazu verglich er den Cholesterinspiegel, den Fettverbrauch und die Herzinfarktrate von sieben Ländern und versuchte, Zusammenhänge zu finden. Er fand sie auch: Je mehr gesättigte Fette gegessen wurden, umso höher waren die Cholesterinspiegel und die Herzinfarktraten. Die Daten stammten aus Italien, Griechenland, Jugoslawien, den Niederlanden, Finnland, Japan und den USA.
Nun zeigte sich aber, dass ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen wäre, wenn Ancel Keys einfach eine andere Länderkombination gewählt hätte, z. B. Finnland, Israel, die Niederlande (ebenfalls), Deutschland, Schweiz, Frankreich und Schweden. Die Herzinfarktrate dieser neuen Länderkombination zeigte, dass die Menschen umso seltener Herzinfarkte erlitten, je mehr gesättigte Fettsäuren sie assen.
Warum also hatte er also ausgerechnet die von ihm bevorzugten Länder gewählt? Vielleicht weil sie seine These so gut belegen konnten?
Nun können manche gesättigte Fettsäuren aber tatsächlich den Cholesterinspiegel erhöhen - allerdings nicht nur das LDL-Cholesterin, sondern auch das HDL-Cholesterin und verbessern damit sogar noch das Verhältnis zwischen LDL- und HDL-Cholesterin). Je besser dieses Verhältnis, umso besser ist man vor koronaren Herzproblemen geschützt. Denn das HDL bewegt ja das Cholesterin wieder aus dem Blut zurück in die Leber. Somit verbleibt also weniger LDL im Blut.
Doch jetzt ist es ja noch so, dass ja gar nicht alle gesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel beeinflussen. Nur drei davon tun dies: Laurinsäure, Myristinsäure und Palmitinsäure. Zwei davon (Laurin- und Myristinsäure) verbessern jedoch - wie bereits erklärt - den Cholesterinquotienten, weil sie das HDL-Cholesterin stärker erhöhen als das LDL-Cholesterin. Nur die Palmitinsäure soll das LDL-Cholesterin mehr steigen (aber nur minimal mehr) als das HDL-Cholesterin.
Jedoch isst man ja nie allein nur die Palmitinsäure. Somit wird deren minimale LDL-Bevorzugung durch die Eigenschaften der anderen Fettsäuren, aus denen ein Fett sonst noch besteht, meist wieder aufgehoben. Alle anderen gesättigten Fettsäuren - und damit der Großteil aller gesättigten Fettsäuren - haben mit dem Cholesterinspiegel gar nichts zu tun. Das heißt, sie beeinflussen ihn in keinster Weise. Sie senken ihn also nicht, erhöhen ihn aber auch nicht. Und kaum zu glauben: Gleichzeitig senken sie sogar die Blutfettwerte (Triglyceride).
Gesättigte Fette senken Blutfettwerte
Gesättigte Fette beeinflussen also kaum den Cholesterinspiegel, sondern sie senken dazu noch die Blutfettwerte. Also bedeutet das jetzt, dass - wenn wir mehr gesättigte Fettsäuren essen - somit gesünder wären?. Denn hohe Blutfettwerte sind in Kombination mit zu niedrigen HDL-Cholesterinwerten (bei zu hohen LDL-Werten) das Problem sehr vieler Menschen. Tatsächlich bei fast allen Menschen, die mit Übergewicht und/oder Bewegungsmangel durchs Leben gehen und damit ein erhöhtes Risiko für Zivilisationskrankheiten aller Art haben.
Wodurch wird denn dann der LDL-Cholesterinspiegel erhöht? Und was treibt die Blutfettwerte in die Höhe? Nun, wenn es also heißt, man solle nur noch wenig Fett essen, was wäre dann die Konsequenz? Genau, man isst jetzt verstärkt Kohlenhydrate und glaubt, dadurch Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und chaotische Blutfettspiegel wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn es dann vor allem die ungesunden Kohlenhydrate sind, was passiert dann? Man wird dicker und kränker.
Isst man viel isolierte Kohlenhydrate (Weissmehl, Zucker, Stärke) wie sie in Kuchen, Teig- und Backwaren, Süssigkeiten, etc. zu finden sind, kann dadurch der Triglyceridspiegel erhöht werden. Sie erhöhen sofort den Blutzuckerspiegel - besonders dann, wenn es Kohlenhydrate mit hoher glykämischer Last sind. Ein permanenter hoher Blutzucker- und Insulinspiegel kann dann zur Fettspeicherung führen. Damit erhöhen sich also auch der Triglyceridspiegel.
Wenn man jetzt hauptsächlich Kohlenhydrate isst - und damit sehr wenig Fett - dann senkt das zwar auch den Cholesterinspiegel, aber eben auch den HDL-Spiegel. Auch soll es wohl so sein, dass dann die LDL-Partikel zwar weniger werden, aber auch kleiner, dichter und kompakter. Diese sehr kleinen Partikel stehen im Verdacht ebenfalls die Blutgefässe zu schädigen.
Gesättigte Fette: Triglyceridspiegel bleibt niedrig
Eine Studie der US-amerikanischen Ohio State University zeigte 2014, dass die Triglyceridwerte durch den Verzehr gesättigter Fettsäuren nicht steigen. Nicht einmal als die Studienteilnehmer doppelt so viele gesättigte Fette assen, stiegen ihre Triglyceridwerte an. Das passierte nur dann, wenn die Testpersonen ihre Kalorien hauptsächlich in Form ungesunder Kohlenhydrate aufnahmen. Eine Ernährung mit gesättigten Fetten hingegen liess den Spiegel wieder sinken.
Weitere Studien bestätigen: Gesättigte Fette sind kein Problem
Ganz ähnliche Zusammenhänge zeigte eine Meta-Analyse von über 70 Studien aus dem Jahr 2014. Forscher der University of Cambridge berichteten darüber in den Annals of Internal Medicine und schrieben, dass ein verstärkter Verzehr gesättigter Fettsäuren das Herz-Kreislauf-Risiko nach Auswertung all dieser Studien offenbar nicht erhöhe.
Im Juli 2015 wurde eine weitere Meta-Analyse veröffentlicht (Russell de Souza von der Michael G. DeGroote School of Medicine in Hamilton/Ontario), die zeigte, dass Fette mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren sich nicht negativ auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkten und das Sterberisiko durch Krankheiten in diesem Bereich nicht erhöhe. Auch das Risiko für Diabetes Typ 2 steige nicht, wenn man gerne gesättigte Fette esse.
Weitere Untersuchungen zeigten auch, dass z.B. der Verzehr von gesättigten Fetten mit einem geringeren Risiko für die koronare Herzkrankheit in Zusammenhang stand, besonders wenn die gesättigten Fette in Form von Käse gegessen wurden. Wurden die gesättigte Fette über andere Lebensmittel verspeist, zeigte sich kein Zusammenhang, also auch kein ungünstiger. Für Kohlenhydrate mit hohem glykämischem Index (Zucker, Auszugsmehle, gesüsste Getränke, Süssigkeiten, Kuchen) zeigte sich, dass sie das Risiko für die Herzkrankheit erhöhten.
Also klar ist, dass diese ungesunden Kohlenhydrate auf Dauer einen negativen Effekt auf die Gesundheit haben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man nun ganz viele tierische Produkte gehen soll. Nein, auch das kann keine gesunde Lösung sein. Denn immerhin gibt es ja auch gesunde pflanzliche Kohlenhydrate. Ebenfalls sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass manche Studien, die gesättigte Fette als harmlos bezeichnen, nicht immer besonders glaubwürdig sein müssen. Denn oft sind die beteiligten Wissenschaftler nicht mehr unabhängig und stehen stattdessen auf den Lohnlisten der Fleisch- und Milchindustrie oder möchten eigene Unternehmen propagieren, etwa Apps zur ketogenen Ernährung.
Tatsächlich gab es auch dazu mal eine Studie - nämlich zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Auch im Jahr 2014 gab es eine gute Studie von Caldwell B. Esselstyn, Arzt und Befürworter der pflanzenbasierten und fettarmen Ernährung.
177 Herz-Kreislauf-Patienten mit Arteriosklerose bzw. koronarer Herzkrankheit (Durchschnittsalter 63) sollen sich pflanzenbasiert und fettarme ernähren - und das durchschnittlich 3,7 Jahre lang.
Die Studienteilnehmer sollten Fleisch, Fisch und Milchprodukte sowie Öle und Fette konsequent meiden. Auch Zucker und damit gesüßte Speisen und Getränke waren tabu, genauso fettreiche Lebensmittel wie Avocados und Nüsse.
Im Laufe der Jahre ging es 144 Patienten besser. 105 davon erlebten eine Verbesserung der Symptomatik, bei 39 bildete sich die Krankheit zurück (Ablagerungen in den Blutgefässen). In der Kontrollgruppe (21 Personen), die sich ganz normal ernährte, verbesserten sich die Beschwerden bei keinem der Patienten - und das obwohl beide Gruppen ihre üblichen Medikamente beibehalten hatten und auch obwohl in der pflanzenbasierten Gruppe Brot und Kartoffeln erlaubt waren.
Dennoch aber gibt es Fettsäuren, die in jedem Fall ein Risiko darstellen und die sich viele Jahrzehnte lang in vielen verarbeiteten kohlenhydratreichen Lebensmitteln befanden (Backwaren, Süßigkeiten). Und das sind die sogenannten "Transfettsäuren". Doch auf dieses Thema kommen wir später genauer zu sprechen.
Betrachten wir uns zum Schluss noch ganz kurz die mittelkettige Fettsäure "Laurinsäure". Denn dazu gibt es einiges an Untersuchungen.
Was ist Laurinsäure?
Laurinsäure auch eine gesättigte Fettsäure, die nach dem lateinischen Namen des Lorbeers (Laurus nobilis) benannt wurde. Denn: Das Öl der Lorbeerpflanze besteht größtenteils aus Laurinsäure.
In folgenden Nahrungsmitteln ist Laurinsäure enthalten:
- Die Früchte der Lorbeeren enthalten ein fettes Öl. Dieses besteht zum größten Teil aus Laurinsäure.
- Kokosöl ist besonders bekannt für seinen Laurinsäure-Gehalt. Kaltgepresstes Kokosöl besteht zu 45 bis 60 Prozent aus Laurinsäure. Ganz wichtig: Wirklich nur kaltgepresstes Öl verwenden, denn raffiniertes Kokosöl enthält kaum noch Laurinsäure, sondern stattdessen schädliche Transfettsäuren.
- Auch in Palmöl ist die Laurinsäure enthalten.
- Laurinsäure findet sich auch in der Muttermilch, allerdings in deutlich geringerer Konzentration.
- In geringen Mengen kommt Laurinsäure auch in Butter oder anderen Milchfetten vor.
Die Laurinsäure hat durchaus positive Wirkungen. Zum Beispiele diese hier:
Einige Forschungen zufolge enthält die Laurinsäure sogenannte HDL-Cholesterine. Diese helfen die Gefäße zu schützen. Damit unterstütze sie das menschliche Kreislaufsystem und senke das Risiko einer Stoffwechselerkrankung.
Die Laurinsäure wirkt zudem antimikrobiell. So schützt sie wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilzinfektionen - was auch der Grund sei, dass sie in der Muttermilch des Menschen und anderer Säugetiere vorkomme.
Aufgrund ihres Geruchs soll die Laurinsäure vor Zecken und einigen anderen Insekten schützen. Reiben Sie Ihre Haut mit etwas Kokosöl ein. Ähnlich wirkt Laurinsäure gegen Milben, Flöhe, Läuse und andere Parasiten. Gerade bei Haus- und Nutztieren wie Hunden oder Pferden kann es helfen, diese mit Kokosöl einzureiben.
Zudem soll Kokosöl unter anderem aufgrund der Laurinsäure die Muskulatur schnell mit Energie versorgen und gegen Muskelverspannungen helfen. Betroffene Muskelpartien können Sie einreiben. Dies kann sowohl prophylaktisch als auch bei Verspannungen helfen.
Quelle:
Laurinsäure - utopia.de
So, soviel also zu den mittelkettigen Fettsäuren. Und nun kommen wir zu einem etwas größeren Teilaspekt dieses Themas, und das sind die Langkettigen Fettsäuren!
Wofür benötigt der Körper die Langkettigen Fettsäuren?
Zur Erinnerung:
Diese Fettsäuren haben ja 14 bis 24 C-Atome. Als Beispiele seien noch einmal genannt:
- Palmitinsäure mit 16 C-Atomen (z. B. im Palmfett, aber auch in tierischen Fetten)
- Ölsäure (18 C- Atome), in Oliven, bzw. Olivenöl, aber auch in Mandelöl, Erdnussöl und Rapsöl
- Stearinsäure (18 C-Atome)
- Linolsäure (18 C-Atome), viel in Sonnenblumenöl, aber auch in Maiskeimöl, Distelöl und andere enthalten
- Eicosapentaensäure ESA (20 C-Atome), in Fisch enthalten, oder Algenöl
- Alpha-Linolensäure (ALA), (18 C-Atome)
- Docosahexaensäure DHA, eine Omega-3-Fettsäure mit 22 C-Atomen, in Fisch enthalten, oder Algenöl
Nun, wo diese Fette überall vorkommen, wofür sie - außer der Ernährung - noch so gebraucht werden, wie ihre chemische Eigenschaften sind - das alles habe ich ja bereits im ersten Teil meiner Fette-Artikel-Serie beschrieben.
Also konzentrieren wir uns hier nur darauf, was der Körper mit diesen Fetten macht und wozu er diese benötigt oder nicht benötigt. Denn diesen Aspekt habe ich ja im ersten Teil bewusst ausgelassen.
-- Palmitinsäure
Palmitinsäure (Hexadecansäure) ist eine gesättigte organische Säure und wird zu den Fettsäuren (= höhere Carbonsäuren) gezählt.
Hier auch noch einmal eine Liste, wo diese Säure sehr oft vorkommt:
Palmöl - 41-46 %
Butterfett - 24-32 %
Schweineschmalz - 24-30 %
Kakaobutter - 23-30 %
Rindertalg - 23-29 %
Baumwollsaatöl - 21 -27 %
Avocadoöl -10 - 26 %
Wirkung auf den Körper:
Palmitinsäure liefert dem Herzen Energie, ist Bestandteil des Säureschutzmantels der Haut, reguliert die Funktionen der Körperzellen, ist ein Hauptspeicher für die Energie des Körpers, fördert die körpereigene Bildung von Vitamin D und der Körper kann damit Eiweiß, Magnesium und Calcium besser aufnehmen.
-- Ölsäure
Die Ölsäure, auch Oleinsäure, ist eine einfach ungesättigte Fettsäure. Unter diesen ist die Ölsäure der wichtigste Vertreter. Sie ist aufgrund der Lage ihrer Doppelbindung eine Omega-9-Fettsäure.
Vorkommen:
Ölsäure kommt chemisch gebunden in Triglyceriden in fast allen natürlichen pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten vor. Sie ist die am häufigsten vorkommende Fettsäure im menschlichen Fettgewebe und nach der Palmitinsäure die zweithäufigste Fettsäure im menschlichen Gewebe insgesamt.
Einen besonders hohen Anteil an veresterter Ölsäure besitzen z. B.
Olivenöl (70-75 %),
Erdnussöl (50-70 %),
Rapsöl (HEAR-Sorten 12-24 %, LEAR-Sorten 50-65 %),
Avocadoöl (44-76 %),
Gänsefett (41-72 %),
Palmöl (37-42 %,
Schweineschmalz (36-52 %),
Sesamöl (35-46 %),
Hammeltalg (31-56 %),
Rindertalg (26-45 %),
Sonnenblumenöl (14-65 %) und insbesondere sogenanntes High-Oleic-Sonnenblumenöl aus speziell gezüchteten Sorten mit 75-93 % Ölsäureanteil.
Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man nur Öle essen muss um an die Ölsäure zu kommen, sondern das die Öle einen höheren Gehalt haben. Mit anderen Worten: Diese Ölsäure ist demnach in Oliven enthalten, in Erdnüsse, in Rapssamen, in Avocados, in Gänsefleisch, in Palmfett, in Sesamkörner, und Sonnenblumenkerne.
Diese Omega-9-Fettsäuren gehören ebenfalls zu den nicht essentiellen Fettsäuren. Das heißt, dass der Körper Ölsäure aus anderen Fettsäuren herstellen kann, wie z.B. aus der Stearinsäure.
Weiterhin ist bekannt geworden, dass Ölsäure ein sogenanntes Depotfett ist. Der Mensch, aber auch viele Tiere und Pflanzen nutzen Depotfett als Vorrat, um Energie zu speichern. Die Fettzellen im Körper lagern neben anderen Fettsäuren auch die Ölsäure ein.
Eine Ernährung, die reichlich Ölsäure enthält, soll noch weiteren Erkrankungen vorbeugen:
Blutdruck:
Studien wiesen nach, dass Olivenöl aufgrund der Ölsäure gesund für das Herz-Kreislaufsystem ist. Die Ölsäure reguliert den Blutdruck und kann so zu hohem Blutdruck vorbeugen.
Cholesterin:
Klinische Studien mit gesunden Probanden, aber auch mit Patienten mit Hyperlipidämie haben bestätigt, dass einfach ungesättigte Fettsäuren in der Lage sind, das Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin zu senken.
Gehirnfunktion:
Weitere Forschungen sehen einen Zusammenhang zwischen einer Ernährung mit Olivenöl und einem niedrigeren Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken.
Krebs vorbeugen:
Eine Studie legt nahe, dass die Ölsäure im Olivenöl schützende Eigenschaften gegen Darmkrebs hat. Weitere Forschungen sehen die Ölsäure in der Nahrung als Schutz vor Brustkrebs.
Außerdem soll die Ölsäure dabei helfen, Leberschäden vorzubeugen, die Blutfette zu regulieren und Entzündungen abzumildern.
Äußerlich:
Da die Ölsäure natürlicherweise im Körper vorkommt, verträgt die Haut die Fettsäure in der Regel gut. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen kann Ölsäure auch die Wundheilung unterstützen. Zum Beispiel kann man hier ein gutes Olivenöl nehmen und auf die Haut auftragen.
-- Stearinsäure
Die gesättigte Stearinsäure ist, wie die Palmitinsäure, eine der Hauptkomponenten in pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten. Dabei besteht Stearinsäure aus 18 Kohlenstoffatomen. Sie wird daher auch als Octadecansäure bezeichnet.
Diese Fettsäure ist fast unlöslich in Wasser. In freier Form stellt sie einen weißen, geschmacklosen Feststoff dar, welcher bei 69 Grad schmilzt und bei 370 Grad siedet. Die Salze der Stearinsäure heißen Stearate. Stearinsäure und Palmitinsäure besitzen ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften. Im Gegensatz zu Palmitinsäure kommt Stearinsäure hauptsächlich in tierischen Fetten vor. Pflanzliche Öle enthalten meist nur bis maximal 7 Prozent Stearinsäure. Sie kommt z.B. in Kokos- und Palmöl vor.
Neben den Triglyzeriden ist Stearinsäure auch in den Zellmembranen und Nervenfasern enthalten. Dort liegt sie als Phospholipid oder Sphingolipid vor. Weil die Palmitinsäure eine ähnliche chemischen Struktur hat wie Stearinsäure, kommen diese beide Fettsäuren immer zusammen vor. Im tierischen oder menschlichen Organismus wird Stearinsäure aus Palmitinsäure durch Anlagerung von zwei Kohlenstoffatomen erzeugt. Daher ist diese Fettsäure nicht essentiell, d.h. der Körper kann Stearinsäure also selbst herstellen.
Wofür braucht der Körper Stearinsäure?
Der Körper nutzt Stearinsäure als Energielieferant, da sie in den Mitochondrien durch den Prozess der Beta-Oxidation in Energie umgewandelt wird. Diese Energie wird für zahlreiche physiologische Prozesse benötigt, darunter Muskelkontraktionen und die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur.
Neben der Energiebereitstellung ist Stearinsäure ein wichtiger Bestandteil von Zellmembranen. Sie trägt zur strukturellen Integrität und Fluidität der Membranen bei, was für die Funktion und Kommunikation der Zellen essenziell ist. Darüber hinaus spielt Stearinsäure eine Rolle bei der Bildung von Ceramiden, die wichtige Bestandteile der Hautbarriere sind und den Wasserverlust der Haut verhindern.
In der Leber wird Stearinsäure in anderen Lipide, wie Phospholipide und Cholesterinester, umgewandelt. Diese Lipide sind wichtig für den Transport von Fettsäuren im Blut und für die Synthese von Hormonen und Vitamin D. Stearinsäure hat zudem eine geringere Tendenz, den Cholesterinspiegel im Blut zu erhöhen, im Vergleich zu anderen gesättigten Fettsäuren wie Palmitinsäure.
Insgesamt erfüllt Stearinsäure zahlreiche Funktionen, die für die Energieproduktion, die Zellstruktur und verschiedene Stoffwechselprozesse im Körper entscheidend sind.
Da Stearinsäure also auch den LDL-Spiegel ein klein wenig erhöht, sollte man auch etwas aufpassen mit der Menge an zugeführter Stearinsäure. Eine hohe Aufnahme von gesättigten Fettsäuren kann auch insgesamt zu Fettleibigkeit beitragen, da sie kalorienreich sind und bei übermäßigen Verzehr zu einer positiven Energiebilanz führen können. Dies kann wiederum das Risiko für verschiedene chronische Erkrankungen wie Type-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten erhöhen.
Bei der Verbrennung von 100 Gramm Stearinsäure werden ungefähr 900 Kilokalorien freigesetzt. Das ist fast das Doppelte der Energie der gleichen Menge an Kohlenhydraten. Besonders energiereich sind die Kohlenwasserstoffbindungen, die bei den langkettigen Fettsäuren in großer Zahl vorliegen. Augrund dieser Energiespeicherfähigkeit eignen sich Stearinsäure und die anderen Fettsäuren als effektive Energiespeicher im Körper.
Neben ihrer Funktion als Energiespeicher ist sie noch ein Hauptbestandteil von Phospholipiden und Sphingolipiden, welche wiederum die Struktur der Zellmembranen und der Membranen der Zellorganellen bestimmen.
Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum entdeckten ebenfalls, dass Stearinsäure eine steuernde Wirkung auf Mitochondrien besitzen könnte. Hierbei fungiert das Stearinsäuremolekül als Signalüberträger und führt zur Fusion von Mitochondrien. Als Folge verbessert sich die Mitochondrienfunktion.
Wo kommt Stearinsäure noch vor?
Sehr reich an Stearinsäure sind Rindertalg, Hammelfett, Butterfett und Schweineschmalz - also in Rind- und Schweinefleisch. Auch in Butter, Sahne und Käse ist diese Fettsäure enthalten.
Aus pflanzlicher Quelle stellt die Kakaobutter den größten Stearinsäurelieferanten da. Andere pflanzliche Öle und Fette besitzen meist nur einen Anteil von maximal 7 Prozent. Shea-Butter enthält z.B. auch Stearinsäure. Durch den Verzehr von dunkler Schokolade kann man so auch Stearinsäure aufnehmen. Auch durch die Verwendung von Kokos- und Palmöl: Beide Öle sind reich an Stearinsäure. Beim Kochen kann man Kokos- oder Palmöl verwenden, um die Zufuhr dieser gesättigten Fettsäure zu erhöhen. Diese Öle eignen sich besonders gut zum Braten und Backen.
Aber auch einige Nüsse und Samen, insbesondere Macadamianüsse und Hanfsamen, enthalten Stearinsäure. Durch den regelmäßigen Verzehr von Nüssen und Samen kann die Aufnahme dieser Fettsäure verbessert werden.
Freie Stearinsäure wird durch Verseifung von Fetten mit kochender Natronlauge hergestellt. Dabei entsteht zunächst das Natriumsalz der Fettsäuren, welche durch die Behandlung mit Mineralsäuren wieder in Fettsäuren überführt werden. Die anschließende Trennung der einzelnen Fettsäuren erfolgt durch spezielle physikalische (Destillation) oder chemische Prozesse. Verwendung findet Stearinsäure in kosmetischen Produkten, Rasierschaum, Reinigungsmitteln oder Waschmitteln.
Quelle:
medlexi - Stearinsäure
-- Linolsäure
Bei der Linolsäure handelt es sich um eine dreifach ungesättigte Fettsäure, bestehend aus 18 Kohlenstoffatomen. Sie gehört zu der Familie der Omega-6-Fettsäuren, die mit den Omega-3-Fettsäuren eng verwandt sind. Es handelt sich dabei um einen essenziellen Nährstoff, der also dem Körper von außen, zum Beispiel mit der Nahrung, in ausreichender Menge zugeführt werden muss. Linolsäure ist jedoch nicht das gleiche wie die Alpha-Linolensäure. Denn letzteres ist eine Omega-3-Fettsäuren
Wozu benötigt der Körper diese Fettsäure?
Linolsäure ist ein maßgeblicher Bestandteil unserer Haut und trägt als solcher dazu bei, unseren Wasserhaushalt zu regulieren. So macht die Linolsäure bei einer gesunden Haut circa 20 Prozent der vorkommenden Fettsäuren aus. Der größte Teil befindet sich dabei in der äußersten Schicht der Haut, der Epidermis. Weiterhin sorgt sie - auch als Bestandteil der Ceramide - für schöne, gesunde Haut und glänzende Haare. Ceramide sind als wertvolle Fette am Aufbau der obersten Hautschicht beteiligt. Sie sind wichtig für gesunde und widerstandsfähige Haut, da sie für die Aufrechterhaltung der Hautbarriere sorgen. Durch einen Mangel an Linolsäure kann sich eine Barriere-Störung entwickeln. was zu Folge hat, dass die Haut trocken und schuppig wird, wobei sie zugleich eine recht ungesunde Färbung aufweist. Weiterhin neigen die Nägel zur Brüchigkeit und ein Teil der Haare kann ausfallen.
Dies ist auch ein Grund warum Linolsäure in vielen Cremes und anderen Kosmetikprodukten zum Einsatz kommt. Sie wirkt dabei gegen Hautreizungen, Mitesser, Altersflecken und Lichtschädigungen und Brandwunden. Außerdem repariert sie langfristig Barriere- und Verhornungsstörungen.
Wo kommt Linolsäure vor?
Linolsäure kommt in hohen Mengen vor allem in pflanzlichen Ölen vor. Öle, die einen hohen Gehalt an Linolsäure aufweisen, sind zum Beispiel:
- Traubenkernöl
- Distelöl
- Sonnenblumenöl
- Hanföl
- Sesamöl
Auch Nüsse und Samen sind gute Quellen für die essentielle Fettsäure. Vertreter dieser Gruppe, die dich mit besonders viel Linolsäure versorgen, sind:
- Walnüsse
- Pinienkerne
- Sonnenblumenkerne
- Hanfsamen
- Sesam
- Pekannüsse
- Paranüsse
Bei den tierischen Lebensmittel haben besonders fettreiches Fleisch und Wurst einen hohen Anteil an Linolsäure. Sie enthalten jedoch auch viel gesättigte Fettsäuren.
Wieviel Linolsäure benötigen wir?
Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollte die Linolsäure bei Erwachsenen circa 2,5 Prozent des gesamten Energiebedarfs ausmachen. Wenn Sie z.B. täglich 2000 Kalorien aufnehmen, entspricht dies etwa 50 Kalorien. So lange Sie genügend gesunde Fettquellen wie Nüsse, Samen und pflanzliche Öle in den Speiseplan integrieren, müssen Sie sich über den Linolsäure-Bedarf keine Gedanken machen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir sogar mehr oder wenige ungewollt (vor allem wenn man nicht so sehr auf seine Ernährung achtet) mehr Omega 6-Fettsäuren zu uns nehmen als eigentlich nötig - und gleichzeitig zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Doch auf diese Thematik komme ich gleich näher zu sprechen.
Gehen wir erst noch die anderen beiden Langkettigen Fettsäuren durch.
-- Alpha-Linolensäure (ALA)
Alpha-Linolensäure ist eine Omega-3-Fettsäure, die in vielen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist. Sie besteht aus 18 Kohlenstoffatomen und ist eine dreifach ungesättigte Fettsäure. Als eine der besten Quellen für die Alpha-Linolensäure - die mit ALA abgekürzt wird - gilt das Leinöl. Es kann bis zu 60 Prozent aus Alpha-Linolensäure bestehen.
Die Alpha-Linolensäure gilt als essentielle Fettsäure, muss also mit der Nahrung aufgenommen werden, weil sie nicht selbst vom Organismus hergestellt werden kann.
Der Tagesbedarf eines Erwachsenen an ALA beträgt in etwa 2 g (2000 mg) ausgehend von einem durchschnittlichen Energiebedarf von 2000 kcal. Diese 2 g können bereits mit 1 TL Leinöl aufgenommen werden.
Im Durchschnitt enthält Leinöl ungefähr diese Menge an an ungesättigten Fettsäuren:
- Alpha-Linolensäure (Omega 3): 53 %
- Linolsäure (Omega 6): 14 %
Weiterhin enthält Leinöl ca. bis zu 19 % Ölsäure und insgesamt ca. 10 % Palmitin- und Stearinsäure. Diese Werte dieser Fette können je nach Sorte etwas schwanken.
Das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis des Leinöls beträgt 1 : 3,7.
Will man lieber ganze Leinsamen essen statt nur das Öl, dann sehen die Werte im Durchschnitt ungefähr so aus:
1 Teelöffel Leinsamen (5 g) enthält ca. 36,5 % Öl/Fett, was 1,8 g entspricht. In diesen 1,8 g Öl sind 1 g Omega-3-Fettsäuren (Alpha-Linolensäure) enthalten und 0,27 g Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure). 2 TL können daher den Tagesbedarf eines Erwachsenen an ALA decken (2 g).
1 Esslöffel Leinsamen ergibt ungefähr die doppelte Menge - also 10 g - und damit auch die doppelten Mengen an Fettsäuren.
Damit die enthaltenen Fettsäuren auch verdaut und verwerten werden können, müssen die Samen geschrotet oder gemahlen sein. Denn ganze Samen kann der Körper nicht aufbrechen. Diese quellen dann nur auf und werden dann unverändert wieder ausgeschieden.
Aber auch andere Öle - wenn auch weniger - enthalten diese Alpha-Linolensäure, wie z.b. die pflanzliche Öle Walnuss-, Raps- und Sojaöl
Weitere Lebensmittel, die gute Mengen ALA enthalten, sind:
Chiasamen - 17830 mg/100 g
Sojabohnenöl - 6789 mg/100 g
Haferkeim - 1400 mg/100g,
getrocknete Spirulina - 800 mg/100 g
Weizenkeim - 700 mg/100 g
Mandeln - 400 mg/100 g
Edamame-Bohnen - 358 mg/100 g
weiße Bohne - 177 mg/100 g
Weizenvollkornbrot - 137 mg/100 g
Avocado - 111 mg/100 g
Brokkoli - 100 mg/100 g
Spinat - 100 mg/100 g
Kopfsalat - 100 mg/100 g
Himbeeren - 100 mg/100 g
Erdbeeren - 100 mg/100 g
Quelle:
Alpha-Linolsäure - ostrovit.de
Wie auch bereits im ersten Teil gesagt, gilt die ALA deshalb als essentiell und wichtig, weil sie die Vorstufe der beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure) ist. Die tatsächliche Wirkung auf die Gesundheit haben aber nur DHA und EPA.
Die Alpha-Linolensäure kann zwar im Organismus zu einem gewissen Teil in DHA und EPA umgewandelt werden. Diese Umwandlung gilt jedoch als unsichere Angelegenheit, weil sie von vielen Faktoren abhängt und daher bei vielen Menschen höchstwahrscheinlich nicht zu einer ausreichenden Bildung von DHA und EPA führt.
Um die Umwandlung in EPA und DHA gewährleisten zu können, werden für die Verstoffwechselung bestimmte Mikronährstoffe, insbesondere Pyridoxin (Vitamin B6), Biotin, Calcium, Magnesium, Zink und Vitamin E benötigt. Ein Mangel an diesen Mikronährstoffen führt zur Verminderung der Umdwanldungsaktivität im Körper und in der Folge zu einer eingeschränkten EPA- sowie DHA-Synthese.
Jedoch aber hat auch die ALA-Fettsäure einige positive Wirkungen auf die Gesundheit - unabhängig davon ob sie umgewandelt wird oder nicht.
Es gibt einige Studien, die aufzeigen, dass die ALA auch teilweise den LDL.Wert senken, den Triglycerdispiegel, Blutdruck und einige Entzündungsmarker.
Die Alpüha-Linolensäure hat nämlich auch eine entzündungshemmende Wirkung. Der Verzehr von ALA kann sogar auch der Vorbeugung und Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen von Bedeutung sein. Auch gibt es einige Hinweise darauf, dass die Einnahme von ALA die Symptome von Depressionen verringern können.
Quelle:
ALA, Gesundheitliche Eigenschaften - ostrovit.de
-- Die Eicosapentaensäure EPA
Eicosapentaensäure ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure (5-fach). Sie besitzt 20 C-Atome und gehört zur Klasse der Omega-3-Fettsäuren.
Diese Fettsäure können wir entweder direkt aus der Nahrung aufnehmen, oder wir nehmen Lebensmittel auf, die ALA enthalten und lassen den Körper diese in EPA umwandeln. Doch, wie schon gesagt, ist die Umwandlung von mehreren Faktoren abhängig und funktioniert nicht immer so gut und wenn, dann wird nur sehr wenig ALA in EPA umgewandelt. Daher ist die direkte Aufnahme von EPA am besten.
Doch nun ist es so, dass EPA kaum in pflanzlicher Nahrung vorkommt, dafür aber umso mehr in verschiedene Fischarten, wie Makrele, Hering, Aal und Lachs
Dennoch aber gibt es eine pflanzliche Quelle, die gute Mengen an EPA (und DHA) enthalten, und das sind spezielle Mikroalgen (Schizochytrium sp.). Diese enthalten die erforderlichen langkettigen Fettsäuren Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure in hohen Mengen. Zu den Mikroalgen wird diese Alge deshalb gezählt, da sie nur aus einer einzigen Zelle besteht. Sie ist also winzig klein. Fischölkapseln sind daher zur Versorgung mit den wichtigen Fettsäuren nicht erforderlich. Achten Sie beim Kauf von (veganen) Algenöl-Kapseln allerdings auf die enthaltene Dosis. Eine Tagesdosis sollte zur Deckung des Tagesbedarfs um die 800 mg EPA und DHA enthalten.
Der Vorläufer der EPA, nämlich die Alpha-Linolensäure, wird insofern umgewandelt, dass durch Einfügung von Doppelbindungen (wodurch aus einer gesättigten eine ungesättigte Verbindung wird) und Verlängerung der Fettsäurekette um 2 C-Atome die Alpha-Linolensäure im strukturreiche Zellorgane mit einem Kanalsystem von Hohlräumen, die von Membranen umgeben sind, von weiße Blutkörperchen und Leberzellen zu EPA verstoffwechselt wird.
Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen im Vergleich zu Männern eine effektivere EPA-Umwandlung aufweisen, was auf die Effekte des Östrogens zurückgeführt werden kann. Während gesunde junge Frauen etwa 21 % der über die Nahrung zugeführten Alpha-Linolensäure zu EPA konvertieren, wird bei gesunden jungen Männern die Alpha-Linolensäure aus der Nahrung nur zu etwa 8 % zu EPA umgewandelt.
Wie auch schon weiter oben gesagt, benötigt der Körper für die Verstoffwechselung einige Nährstoffe, insbesondere Vitamin B6, Biotin, Calcium, Magnesium und Zink. Ein Mangel an diesen Mikronährstoffen führt zur Verminderung der Umwandlungsaktivität.
Außerdem gibt es auch einige andere Faktoren, die diese Umwandlung hemmen können, und das sind:
- Erhöhte Zufuhr gesättigter und ungesättigter Fettsäuren, wie Ölsäure und Linolsäure
- Alkoholkonsum in hohen Dosen und über einen längeren Zeitraum, chronischer Alkoholkonsum
- Erhöhter Cholesterinspiegel
- Insulinabhängiger Diabetes mellitus
- Virusinfektionen]
- Stress
- Ausschüttung lipolytischer Hormone, wie Adrenalin, das durch Stimulation der Triglyceridlipase zur Spaltung von Triglyceriden und Freisetzung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren führt.
Ebenfalls konkurrieren Alpha-Linolensäure und Linolsäure bei der Synthese anderer biologisch wichtiger mehrfach ungesättigter Fettsäuren um die gleichen Enzymsysteme, wobei alpha-Linolensäure im Vergleich zur Linolsäure eine höhere Bindungsstärke zur dem Enzym, welches ALA in EPA umwandelt (delta-6-Desaturase) aufweist.
Wird beispielsweise mehr Linolsäure als Alpha-Linolensäure über die Nahrung zugeführt, kommt es zu einer gesteigerten Synthese der entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäure (Arachidonsäure) und zu einer verminderten körpereigenen Synthese der entzündungshemmenden wirksamen Omega-3-Fettsäure EPA. Daran kann man erkennen wie wichtig das mengenmäßig ausgewogenen Verhältnisses von Linolsäure zu Alpha-Linolensäure in der Nahrung ist. Nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte das Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren der Nahrung im Sinne einer präventiv wirksamen Zusammensetzung 5:1 betragen.
Die aus der heutigen Ernährungsweise zu hohe Zufuhr von Linolsäure (durch Getreidekeimöle, Sonnenblumenöl, Pflanzen- und Diätmargarine etc.) und die unzureichende Enzymaktivität, (nämlich eben vor allem der delta-6-Desaturase) und der häufig vorkommenden Mikronährstoffmängel, Nährstoffinteraktionen, hormonellen Einflüssen und so weiter, kommt es eben zu einer sehr langsamen EPA-Synthese aus ALA zu EPA, und auch in zu geringen Mengen (durchschnittlich maximal 10 %). Deswegen gilt EPA aus heutiger Sicht als essentielle (lebensnotwendige) Verbindung. Um die erforderliche Menge von 1 g EPA zu erreichen, ist die Aufnahme von etwa 20 g reiner Alpha-Linolensäure - entsprechend circa 40 g Leinöl - notwendig. Diese Menge ist jedoch nicht praktikabel, was den Konsum von EPA-reichen Kaltwasserfischen, wie Hering und Makrele, (2 Fischmahlzeiten/Woche, entsprechend 30-40 g Fisch/Tag), oder aber eben die direkte Gabe von EPA durch Algenöl-Kapseln so bedeutsam macht. Nur eine EPA-reiche Ernährung gewährleistet optimale Konzentrationen dieser hochungesättigten Fettsäure im menschlichen Körper.
In den Zellen der Zielgewebe, wie Blut, Leber, Gehirn, Herz und Haut, kann EPA - je nach Funktion und Bedarf der Zelle - in die Phospholipide der Zellmembranen sowie der Membranen von Zellorganellen, wie Mitochondrien ("Energiekraftwerke" der Zellen) und Lysosomen (Zellorganellen mit saurem pH-Wert und Verdauungsenzymen), eingebaut, als Ausgangssubstanz zur Synthese von entzündungshemmenden hormonähnliche Substanzen, die als Immunmodulatoren und Neurotransmitter wirken, gespeichert werden.
Quelle:
EPA - Transport und Verteilung - vitallstoff-lexikon.de
Welche Wirkungen hat EPA?
Eine der bemerkenswertesten Wirkung von EPA ist, wie bereits angedeutet, ihre Fähigkeit, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Entzündungen sind an der Entstehung vieler chronischer Krankheiten beteiligt, von Herzkrankheiten über Arthritis bis hin zu Krebs. EPA kann diese entzündlichen Prozesse hemmen und dazu beitragen, das Risiko für diese Krankheiten zu senken.
Darüber hinaus spielt EPA eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Herzgesundheit. Sie hilft dabei, den Blutdruck zu regulieren, die Triglyceridspiegel im Blut zu senken und die Blutgerinnung zu verbessern.
Hier mal eine Liste der Mengenangeben von EPA in verschiedenen Fischen. Doch Achtung: Bei Fisch muss man etwas auf die Belastung durch Schwermetalle aufpassen. Daher immer auf Qualität achten!
Lebensmittel --- EPA-Gehalt (pro 100g)
Lachs 1000-2000 mg
Makrele 500-1500 mg
Sardinen 300-1000 mg
Hering 500-1000 mg
Thunfisch 300-1000 mg
Heilbutt 200-500 mg
Forelle 200-500 mg
Forellenölpräparate 300-500 mg
Kabeljau 200-500 mg
Schwertfisch 200-500 mg
Quelle:
EPA - molegular.com
-- Docosahexaensäure DHA
Docosahexaensäure ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure und gehört ebenfalls der Klasse der Omega-3-Fettsäuren an. Sie ist eine 6-fach-Fettsäure und besitzt 22 C-Atome.
DHA kann ebenso wie EPA über die Nahrung, vor allem durch Öle von fettreichen Meeresfischen, wie Makrele, Hering, Aal und Lachs, zugeführt als auch im menschlichen Organismus aus der essentiellen Alpha-Linolensäure gebildet werden.
Der relativ hohe Gehalt an DHA im Fett vieler Kaltwasserfischarten stammt direkt aus der Nahrungskette beziehungsweise aus der Vorstufe Alpha-Linolensäure durch Zufuhr von Algen, wie Spirulina, und Krill (Kleinkrebse, garnelenartige Wirbellose) Untersuchungen haben ergeben, dass in Fischfarmen gezüchtete Fische, denen die natürlichen Nahrungsquellen der Omega-3-Fettsäuren fehlen, signifikant niedrigere DHA-Konzentrationen aufweisen als unter natürlichen Bedingungen lebende Fische.
Auch hier geschieht die Umwandlung durch Einfügung von Doppelbindungen, wodurch aus einer gesättigten eine ungesättigte Verbindung wird, und der Verlängerung der Fettsäurekette um jeweils 2 C-Atome die Alpha-Linolensäure. Auch hier spielen Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und Leberzellen eine Rolle.
DHA dient wiederum als Ausgangssubstanz für die Eigen-Synthese von entzündungshemmenden Stoffen (Docosanoiden) und von anderen Stoffen, die das Überleben von Nervenzellen und Nervenfasern fördern, z.B. für das Immunsystem und des Gehirns.
Frauen weisen auch hier im Vergleich zu Männern eine effektivere DHA-Synthese aus Alpha-Linolensäure auf, was auf die Effekte des Östrogens zurückgeführt werden kann. Während gesunde junge Frauen etwa 21 % der über die Nahrung zugeführten Alpha-Linolensäure zu EPA und 9 % zu DHA konvertieren, wird bei gesunden jungen Männern die Alpha-Linolensäure aus der Nahrung nur zu etwa 8 % in EPA und nur zu 0-4 % in DHA umgewandelt.
Ebenfalls benötigt der Körper für diesen Stoffwechselvorgang bestimmte Nährstoffe, wie z.B. Vitamin B6, Biotin, Calcium, Magnesium und Zink. Ein Mangel an diesen Mikronährstoffen führt zur Verminderung der Enzymaktivität und in der Folge zu einer eingeschränkten DHA-Synthese.
Neben einem Mikronährstoffmangel wird die Umwandlungs-Aktivität ebenfalls durch folgende Faktoren gehemmt:
- Erhöhte Zufuhr gesättigter und ungesättigter Fettsäuren, wie Ölsäure und Linolsäure
- Alkoholkonsum in hohen Dosen und über einen längeren Zeitraum, chronischer Alkoholkonsu<
- Erhöhter Cholesterinspiegel
- Insulinabhängiger Diabetes mellitus
. Virusinfektionen
- Erkrankungen, wie Lebererkrankungen
, Stress
- Ausschüttung von Adrenalin, das durch Stimulation der Triglyceridlipase zur Spaltung von Triglyceriden und Freisetzung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren führt
Wozu wird DHA vom Körper benötigt?
Die exogene Zufuhr von DHA spielt besonders während der Schwangerschaft und Stillzeit eine entscheidende Rolle, da weder das Ungeborene noch das Kleinkind aufgrund eingeschränkter enzymatischer Aktivitäten in der Lage ist, ausreichende Mengen der essentiellen Omega-3-Fettsäure DHA selbst zu synthetisieren.
DHA fördert die Entwicklung des Gehirns, des zentralen Nervensystems und des Sehvermögens des Fetus noch während der Schwangerschaft, aber auch im Verlauf der Stillzeit und der weiteren kindlichen Entwicklung.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Brustdrüse DHA synthetisiert. Im Gegensatz zur Kuhmilch findet sich diese nämlich in der menschlichen Muttermilch. Das Baby benötigt die Docosahexaensäure besonders in den ersten Lebensjahren zum Aufbau des relativ grossen Menschengehirns. Schwangeren wird demnach zu einer Zufuhr von mindestens 200 mg DHA pro Tag geraten, um die Gehirnentwicklung ihres Babys positiv zu unterstützen.
Eine Untersuchung aus Norwegen kam zu dem Ergebnis, dass 4-jährige Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft und während der ersten drei Monate der Stillzeit mit Lebertran supplementiert wurden (2 g EPA + DHA/Tag), bei einem IQ-Test deutlich besser abschnitten als solche 4-Jährige, deren Mütter keine Supplementation mit Lebertran erhielten. Eine Unterversorgung mit DHA im vorgeburtlichen und frühkindlichen Wachstum kann demnach die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes beeinträchtigen und zu einer geringeren Intelligenz - vermindertes Lern-, Erinnerungs-, Denk- und Konzentrationsvermögen - und schlechteren Sehfähigkeit beziehungsweise -schärfe führen.
DHA vitalstoff-lexikon.de
Die höchste Konzentration von DHA im Körper findet sich im Gehirn, im Nervensystem und in der Netzhaut, wo sie in die zellulären und intrazellulären Membranen, Synapsen, Photorezeptoren und die Myelinscheide um die Nerven eingebaut ist. Fettsäuren sind wichtig für die Signalübertragung.
Eine ausreichende Zufuhr von DHA ist daher entscheidend für den richtigen Aufbau und die Funktion des (zentralen) Nervensystems.
Der Verlust von DHA aus den Membranen wird mit einer verschlechterten Gehirnleistung in Verbindung gebracht. Inwiefern genau, können Sie detaillierter nachlesen.
EPA und DHA - naturafoundation.de
Langfristige suboptimale Zufuhr von DHA (und EPA) erhöht das Risiko für Entwicklungsstörungen in der Kindheit wie ADHS und für Depression, Schizophrenie, kognitiven Abbau und metabolisches Syndrom.
Supplementierung von DHA und EPA
- Algen
In unserem Ökosystem sind Algen und anderes Phytoplankton die Hauptproduzenten von EPA und DHA. Studien bestätigen, dass die positiven Auswirkungen von Omega-3 aus Algen denen von Fischöl ähnlich sind. Das Phytoplankton steht an der Basis der marinen Nahrungskette. Daher ist es im Gegensatz zu Fisch kaum belastet. Algen können als eine sehr reine pflanzliche Quelle für EPA und DHA angesehen werden. Aufgrund seines pflanzlichen Ursprungs ist das Algenöl für Vegetarier und Veganer geeignet. Auch Nicht-Fischesser und Menschen mit einer Fischallergie können durch den Verzehr von Algen oder die Supplementierung mit Algenöl einen ausreichenden Omega-3-Status erreichen.
- Krill
Krill sind garnelenartige Meerestiere. Krillöl wird aus Krill gewonnen. Krill wird aus den polaren Gewässern um die Antarktis gefischt und steht am unteren Ende der Nahrungskette. Daher ist er arm an Schwermetallen und anderen Schadstoffen. Krillöl enthält von Natur aus hohe Konzentrationen an Astaxanthin, einem natürlichen Antioxidans. Die hohen antioxidativen Eigenschaften dieses Öls tragen zur Stabilität des Krillöls bei.
- Fisch
Fettreiche Fische wie Makrele, Forelle, Lachs, Hering, weißer Thunfisch und Sardinen produzieren selbst keine EPA und DHA, sondern nehmen sie über Phytoplankton aus dem Meer auf.
Fisch hat einen hohen Nährwert in Bezug auf Fett, aber auch Eiweiß, fettlösliche Vitamine und Mineralien wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Zink, Selen und Kupfer. Im Vergleich zu wild gefangenem Fisch enthalten Zuchtfische in der Regel ein schlechteres Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Die Fischart, die in Deutschland am häufigsten gegessen wird, ist Hering, gefolgt von Kabeljau, Seelachs und Lachs.
Und an dieser Stelle mal ein kurzer Hinweis, falls Ihnen das nicht aufgefallen ist: Also, die Fische Tiere fressen Algen und kommen so an ihr Omega 3 DHA und EPA. Damit sind die Algen die tatsächliche ursprüngliche Quelle von Omega-3-Fettsäuren. Insofern ergibt es für den Menschen doch Sinn, sich ebenfalls von Algen zu ernähren um an Omega-3 heran zu kommen - völlig unabhängig davon ob man sich nun vegan ernährt oder nicht.
Interaktionen mit anderen Stoffen
Ungesättigte Fettsäuren sind anfällig für Oxidation, auch nach der Aufnahme. Ein gutes Fettsäurepräparat (Nahrungsergänzungsmittel) enthält Antioxidantien wie Vitamin E zum Schutz der Fettsäuren. Zusätzlich kann dieser Schutz durch die gleichzeitige Einnahme eines Vitamin-E-Präparates unterstützt werden.
Tierstudien zeigen, dass die gleichzeitige Einnahme von Flavonoiden und Omega-3-Fettsäuren zu höheren EPA/DHA-Werten im Blut führt, als wenn nur Omega-3-Fettsäuren supplementiert werden. Die Einnahme eines Flavonoid-Ergänzungsmittels oder einer flavonoidreichen Ernährung kann die Bioverfügbarkeit und/oder Wirkung von Omega-3-Fettsäuren unterstützen.
Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA bilden zusammen mit Cholin eine synergistische Kombination von Gehirnbaustoffen, die auch einen normalen Fettstoffwechsel unterstützt. Eine Studie zeigt zum Beispiel, dass die neurologische Entwicklung besser ist, wenn die Mutter sowohl Cholin als auch Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzung erhält. Diese Entwicklung ist aufgrund der synergistischen Nährstoffe besser
Olivenöl fördert die Aufnahme von Fettsäuren und/oder die Absorption von Fettsäuren im Darm. Die gleichzeitige Aufnahme von Olivenöl und Omega-3-Fettsäuren erhöht die Bioverfügbarkeit der Omega-3-Fettsäuren. Diese Art der Supplementierung kann z. B. bei Rheuma effektiv eingesetzt werden.
Vitamin A spielt eine synergistische Rolle beim Schutz vor der Entzündungsreaktion bei MS. Omega-3-Fettsäuren haben eine neuroprotektive Rolle, Vitamin A unterstützt diese. Die Kombination von Omega-3 und Vitamin A ist stärker als ihre Einzelwirkungen.
Mehrere Studien zeigen, dass eine gleichzeitige Supplementierung mit Omega-3 und hohen Dosen von Vitamin D3 bei der Behandlung/Prävention von Diabetes wirksam sein kann. Auch Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes profitieren von einer Vitamin-D3- und Omega-3-Supplementierung. Diese Kombination ist wirksamer als die alleinige Supplementierung mit Vitamin D3 oder Omega-3.
Quelle:
EPA und DHA - naturafoundation.de
So, damit haben wir uns nun auch die Langkettigen Fettsäuren angeschaut.
Jetzt ist es ja so, dass wir ja ein gutes Verhältnis zwischen Omega-6- und Omega-3.Fettsäuren benötigen. Mit der üblichen westlichen Ernährungsart nehmen wir meist viel mehr Omega-6 auf als Omega 3. Wie ja nun einige Male beschrieben, kann dies zu einigen Problemen führen, u.a. zu erhöhten Entzündungsprozessen im Körper. Schauen wir uns dieses Verhältnis mal etwas genauer an.
Omega-6 VS Omega 3
Sowohl Omega-3- als auch Omega-6-Fettsäuren sind Vorstufen von sogenannten Eicosanoiden, einschließlich Prostaglandinen.
Elcosanoide sind eine Gruppe von hormonähnlichen Substanzen, die aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren gebildet wurden. Sie können als intra- und extrazelluläre Signalmoleküle wirken und sind in eine Vielzahl biologischer Wirkmechanismen eingebunden.
Prostaglandine sind von der Arachidonsäure abgeleitete Lokalhormone. Sie spielen eine Rolle bei der lokalen Schmerzvermittlung und als Botenstoffe für die Wirkung von Hormonen, sowie bei der Entstehung von Fieber und bei Entzündungsprozessen.
Die Eicosanoide aus EPA sind Antagonisten (Gegenspieler) der Eicosanoide aus der Arachidonsäure. Sie verhindern übermäßige Entzündungen, Thrombose und Gefäßverengungen.
Zur Erinnerung: Die Arachidonsäure ist eine ungesättigte Omega-6-Fettsäure, die der Körper aus der Linolsäure herstellt. Sie hat eine entzündungsförderne Funktion. Die Arachidonsäure wird zwar auch benötigt, um die Bausteine für Hormone zu liefern, mit denen der Körper die Immunabwehr aktivieren kann, jedoch kann diese Fettsäure auch problematisch werden wenn zuviel davon vorhanden ist. Und das geschieht ja, wenn man zuviel Omege-6 aufnimmt, oder viel von den Lebensmitteln isst, die diese Fettsäure auch enthalten. Sie kommt hauptsächlich in Fetten von tierischem Ursprung vor: Größere Mengen sind vor allem in fetthaltigem Fleisch und Innereien sowie in Fetten wie Butter oder Schmalz enthalten. Essen Sie also viel Fleisch, nimmt der Körper dabei viele Stoffe auf, die das Immunsystem aktivieren. Es fehlen jedoch die Stoffe, die es wieder deaktivieren. So kann es zu einer Überreaktion des Immunsystems kommen. Dabei können Entzündungen entstehen, die sich gegen eigentlich harmlose Stoffe richten.
Da die Arachidonsäure eben vom Körper selbst hergestellt werden kann, ist sie nicht essentiell, bzw. man sagt, sie sei semi-essentiell. Denn sie wird hergestellt und dann auch gebraucht, indem man die essentielle Fettsäure Linolsäure über die Nahrung aufnimmt
Wenn also die Zusammensetzung der Fettsäuren in den Zellmembranen im Gleichgewicht ist, verlaufen Entzündungsreaktionen regulär. Wenn Arachidonsäure während einer Entzündung in der Membran dominiert, kann es zu einem Überschuss an entzümdungsversursachenden Eicosanoiden, wie eben Prostaglandin, kommen. Wenn die EPA-, DHA- Spiegel im Normalbereich liegen, wird das Gleichgewicht zwischen den entzündlichen Eicosanoiden und den entzündungshemmenden Eicosanoiden wiederhergestellt und die Entzündungsreaktion, der Blutdruck und die Blutgerinnung werden wieder besser reguliert.
Das optimale gesunde Gleichgewicht der beiden Fettsäuren sollte in etwas - je nach Quelle - 5 zu 1 (Omega 6 zu Omega 3) sein; oder 3 zu 1. Die erste Zahl steht immer für Omega-6 und die zweite Zahl immer für Omega-3.
Heutzutage liegt das Verhältnis - bei der üblichen westlichen Ernährungsart - nicht selten bei Werten um 50 : 1 oder darüber.
Wenn man sich nun die beliebtesten Speiseöle anschaut, so zeigt sich, dass beispielsweise Sojaöl und Sonnenblumenöl ein Verhältnis von über 120 : 1 aufweisen, das Maiskeimöl 55 : 1 und das besonders in Vollwertkreisen beliebte Distelöl 150 : 1.
Um ALA in EPA und DHA umzuwandeln, werden ja die weiter oben beschriebenen Enzyme benötigt. Da diese Enzyme auch die Omega-6-Fettsäuren in andere Fettsäuren umwandeln, werden in Anwesenheit von reichlich Omega-6-Fettsäuren die Enzyme für deren Verwandlung aufgebraucht. Für die ALA-Verwandlung bleibt kaum noch etwas übrig.
Ungünstigerweise entstehen dabei u. a. entzündungsfördernde Fettsäuren (Arachidonsäure), so dass ein Übermass an Omega-6-Fettsäuren chronische Entzündungsprozesse verstärken kann.
Ein schlechtes Omega-6-Omega-3-Verhältnis wird daher mit der Entstehung vieler Krankheiten in Verbindung gebracht - die allesamt mit chronischen Entzündungen einhergehen - einschliesslich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Osteoporose, Diabetes, Autoimmunerkrankungen uvm.
Omega-6-Fettsäuren verhindern nicht nur die Umwandlung von ALA in EPA und DHA, sondern hemmen auch deren Einbau in das Gewebe, so dass bei einem hohen Omega-6-Verzehr nicht einmal die per Nahrungsergänzung eingenommenen langkettigen Fettsäuren optimal genutzt werden könnten.
Quelle:
Omega 3 mit veganer Ernährung decken - zentrum-der-gesundheit.de
Arachidonsäure: Diese Lebensmittel enthalten besonders viel
Wie gesagt, ist Arachidonsäure besondern viel in Tierprodukten zu finden. Wenn Sie also an Rheuma oder Arthrose leiden, sollten Sie dio folgenden Lebensmittel nach Möglichkeit ganz vom Speiseplan streichen oder zumindest stark reduzieren.
Dies tierischen Produkte sind reich an Arachidonsäure (die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 Gramm):
- Schweineschmalz:
Enthält 1,7 Gramm Arachidonsäure (höchste Gehalt von allen hier augelisteten Produkten)
Achtung: Auch in Gebäck mit Schweineschmalz, wie etwa Spritzgebäck und anderen Weihnachtsplätzchen, stecken oft größere Mengen der problematischen Fettsäure.
- Leber und Leberwurst:
Schweineleber (491 Milligramm)
Leberwurst (227 Milligramm)
Schweinefleisch (36 Milligramm) und durchwachsener Speck (250 Milligramm).
- Fisch und Meerestiere:
Einige Sorten enthalten nicht nur Omega-3-Fettsäuren, sondern auch Arachidonsäure. Dazu gehören vor allem:
Languste (190 Milligramm)
Sardelle (152 Milligramm)
Aal geräuchert (144 Milligramm)
Karpfen (113 Milligramm)
Lachs (111 Milligramm)
Hühnereier:
Mit Eiern nehmen Sie durchschnittlich etwa 70 Milligramm Arachidonsäure auf.
Die folgenden tierischen Produkte enthalten dagegen weniger Arachidonsäure:
Geflügel:
Die mageren Bruststücke eignen sich besser für eine arachidonarme Ernährung: Bei der Pute sind es 55 Milligramm. Das Fleisch an den Schlegeln enthält mehr von der Fettsäure - beim Huhn sind es sogar 330 Milligramm.
Rind oder Kalb:
Filetstücke und mageres Muskelfleisch enthalten relativ wenig Arachidonsäure. In 100 Gramm Kalbfleisch stecken 53 Milligramm, 100 Gramm Rindfleisch (Muskelfleisch) enthalten nur circa 16 Milligramm.
Milchprodukte:
Butter (113 Milligramm)
fetthaltige Käsesorten wie Emmentaler (28 Milligramm)
Lebensmittel mit Arachidonsäure - utopia.de
Ziel einer Ernährungstherapie sollte also sein, den Anteil der Omega-3-Fettsäuren in der Nahrung zu erhöhen und den der Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren. Dies lässt sich am einfachsten erreichen, indem Omega-3-Fettsäure-reiche Nahrungsmittel bevorzugt und Omega-6-Fettsäure-reiche Nahrungsmittel (z. B. Fleisch- und Wursterzeugnisse, Eier) reduziert werden.
Omega 3 - Dosierung
Die optimale therapeutische Dosierung von Omega-3-Fettsäuren pro Tag variiert je nach Erkrankung und hängt von den zu erzielenden Ergebnissen ab. Im Allgemeinen brauchen essentielle Fettsäuren Zeit, um ihre Wirksamkeit zu beweisen. Omega-3-Fettsäuren zeigen ihre Wirkung innerhalb eines Zeitrahmens von 4 Wochen bis etwa 4 Monaten. Bei Krillöl ist die Dosierung oft niedriger als bei Fischöl, da die Bioverfügbarkeit von Krillöl höher ist als bei Fischöl. Bei Krillöl kann eine Erhaltungsdosierung von 500 mg/Tag beibehalten werden. Die optimale therapeutische Dosierung variiert je nach Erkrankung und liegt zwischen 1 und 3 g/Tag.
Die richtige Dosierung für gesunde Menschen - ob nun über die Ernährung oder mit Nahrungsergänzungen aufgenommen:
- 300 mg bis 600 mg oder auch mehr EPA/DHA pro Tag (je nach Bedarf; mehr als 2000 mg sollten in Form von Nahrungsergänzungen nicht eingenommen werden)
- 1.100 bis 1.600 mg ALA pro Tag (mit 1 EL Hanföl sind Sie schon bei 2.000 mg ALA)
Die richtige Dosierung bei Krankheiten
Zu therapeutischen Zwecken werden häufig viel höhere Dosierungen angegeben. Diese reichen bis hin zu 5.000 mg EPA/DHA pro Tag.
Doch Achtung:
Omega-3-Fettsäuren können in höher Dosierungen blutverdünnend wirken. Daher dürfen solche Dosierungen (über 2.000 mg pro Tag) bei Menschen nicht eingesetzt werden, die blutverdünnende Medikamente nehmen oder aus anderen Gründen zu erhöhten Blutungen neigen. Besprechen Sie daher die richtige Dosierung der Omega-3-Fettsäuren immer mit Ihrem Arzt.
Wenn Sie genauer wissen wollen, welche Dosierung bei welchen Krankheiten eingesetzt werden können, dass können Sie sich bei diesem Artikel hier von "Zentrum-der-Gesundheit"eine Liste mit Dosierungen anschauen.
Die Tagesdosis Omega-3-Fettsäuren sollte am besten in mindestens zwei Einzeldosen aufgeteilt werden - was die Resorption verbessert und dazu führt, dass Sie Ihren Körper gleichmäßig mit Omega-3-Fettsäuren versorgen.
Omega-3-Fettsäuren werden mit den Mahlzeiten eingenommen, z. B. je eine Kapsel zum Mittagessen und zum Abendessen.
Doch wie kann man nun genau auf vegane Art - außer durch Algenöl-Kapseln - das Omega-3-Verhältnis verbessern?
Nun, essen Sie verstärkt hochwertige pflanzliche Omega-3-Quellen, die besonders hohe Omega-3-Gehalte aufweisen.
Hier mal eine Liste von Lebensmittel von "Zentrum-der-Gesundheit": Tabelle - Vegane Omega-3-Lebensmittel
Omega 3 in Wildpflanzen
Ja, das weiß kaum jemand, aber auch in "Grünzeug" wie Gemüse und Wildpflanzen stecken Omega-3-Fettsäuren!
Nun sind die Fettmengen in Gemüse und Kräutern natürlich gering (zwischen 0,2 und 2,5 Prozent), doch sind die Omega-3-Fettsäure-Anteile am Gesamtfett wiederum relativ hoch.
Wildpflanzen, wie z. B. der Löwenzahn oder die Brennnessel, enthalten 0,6 Prozent Fett. Pro 100 Gramm sind das also 600 mg. Der Omega-3-Anteil liegt bei 250 mg, der Omega-6-Anteil bei 80 mg.
Und jetzt rechnen Sie mal..
Wir haben hier ein hervorragendes Omega-6-Omega-3-Verhältnis von 1 : 3 !
Kulturgrünpflanzen wie Salate haben meist ein Verhältnis von 1 : 2 und etwas geringere Omega-3-Werte (z. B. Feldsalat 140 mg Omega-3 pro 100 g, Pflücksalat 110 mg, Kopfsalat, Eissalat und Radicchio 90 mg).
Herausragend ist bei den Salaten und Kräutern die Gartenkresse mit 600 mg Omega-3-Fettsäuren und einem Verhältnis von 1 : 3.
Wer also täglich 150 Gramm Blattsalate, Kräuter und Wildpflanzen isst (im Salat und grünen Smoothie, z. B. mit 100 g Feldsalat, 20 g Löwenzahn und 30 g Kresse), kommt gut und gerne auf 370 mg Omega-3-Fettsäuren allein mit Hilfe des Grünzeuges - und zwar ohne sich dabei mit Omega-6-Fettsäuren zu belasten.
Nun isst man in der veganen Ernährung aber auch noch Gemüse, das ebenfalls Omega-3-Fettsäuren liefert.
Gemüse und Omega 3
Blatt- und Kohlgemüse versorgen mit guten Omega-3-Mengen und verfügen gleichzeitig über ein sehr gutes Omega-6-Omega-3-Verhältnis. Wenn man nun also noch etwa 250 Gramm Gemüse zum oben genannten Salat und Smoothie isst, dann kommt man auf durchschnittlich weitere 250 mg Omega-3-Fettsäuren (eher mehr) - ebenfalls ohne sich mit zu vielen Omega-6-Fettsäuren zu belasten.
Hülsenfrüchte und Omega 3
Auch Hülsenfrüchte versorgen mit relevanten Omega-3-Fettsäuren bei einem sehr guten Omega-6-Omega-3-Verhältnis (siehe Tabelle unter obigem Link).
Nahrungsergänzungen
Auch andere Nahrungsergänzungsmittel, liefern Ihnen zusätzliche ALA-Mengen. Hier zwei Beispiele (beachten Sie aber, dass die Werte je nach Produkt und Charge stets schwanken können):
Moringa: 62,4 mg Omega 3 pro 10 g; das Verhältnis Omega-6-Omega-3 liegt bei 1:6
Chlorella: 60 mg Omega 3 pro 4 g; das Verhältnis Omega-6-Omega-3 liegt bei 1:1
Früchte und Omega 3
Früchte sind teilweise ebenfalls interessante Omega-3-Quellen. Lediglich ihr Omega-6-Omega-3-Verhältnis ist meist nicht so gut wie beim Gemüse und den Salaten. Die unten genannten weisen von allen Früchten ein besonders gutes Verhältnis auf:
Heidelbeeren: 175 mg; das Verhältnis Omega-6-Omega-3 liegt bei 1,5:1
Mango: 80 mg; das Verhältnis Omega-6-Omega-3 liegt bei 1:2
Galia-Melone: 60 mg; das Verhältnis Omega-6-Omega-3 liegt bei 1:1,5
Getreide und Omega 3
Getreide weist meist deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren auf als Omega-3-Fettsäuren (siehe Tabelle im obigen Link). Wenn Sie jedoch immer reichlich Gemüse, Salate, Kräuter oder die Omega-3-reichen Öle, Nüsse und Saaten zu sich nehmen, dann bleiben Sie trotz Getreide-/Pseudogetreideverzehrs bei einem sehr guten Omega-6-Omega-3-Verhältnis.
Quelle:
Omega 3 vegan - zentrum-der-gesundheit.de
Sie sehen also: Auch mit der veganen Ernährung ist es problemlos Möglich auf ein gutes Omega 3- Fettsäuren - Verhältnis zu kommen. Man muss eben nur bescheid wissen. Aber das gilt ja für jede Ernährungsart.
Und jetzt noch einmal ein kleinen Überblick über die Vorteile von Omega- 3 - Fettsäuren:
Zusammenfassung: Wirkung und Vorteile von Omega - 3 Fettsäuren
Diese Fettsäuren wirken..
- an der Produktion von Hormonen
- an der Regulierung der Blutfettwerte ( Cholesterin und Triglyceride)
- an der Eiweisssynthese
- am Zellstoffwechsel und am Aufbau der Zellmembran
- an der Versorgung der Gelenke mit Schmierstoff
- an der Vermeidung chronisch entzündlicher Prozesse
- an der Versorgung von Haut und Haaren mit Feuchtigkeit und Spannkraft
- an der Bildung der körpereigenen Abwehrzellen
- am Schutz vor Infektionskrankheiten
- an der Umwandlung von weissem Fettgewebe in braunes Fettgewebe
Quelle:
Omega 3, die Wirkungen - zentrum-der-gesundheit.de
Studien belegen auch eine Senkung des Herzinfarkt-Risikos um 30 bis 50 Prozent, wenn der Körper gut mit den Fettsäuren versorgt ist. Eine in Shanghai durchgeführte Studie mit 18.000 Probanden ergab sogar eine Quote von 70 Prozent Risikoreduktion.
Bei ADHS oder Konzentrations-/Lernstörungen kann auch eine Nahrungsergänzung mit den genannten Fettsäuren zur ganzheitlichen Therapie für betroffene Kinder zur Besserung der Symptome führen.
Im August 2020 erschien eine Studie der University of Derby und der Nottingham Trent University(NTU). Dabei zeigte sich: Je mehr Omega-3-Fettsäuren eine Person zu sich nahm - insbesondere EPA (Eicosapentaensäure), umso besser konnte diese Person ihr eigenes aggressives und impulsives Verhalten unter Kontrolle halten.
Aber auch die Augen werden geschützt, denn wie weiter oben schon gesagt, sind Omega-3-Fettsäuren auch Bestandteil der Netzhaut. Es gibt daher auch Untersuchungen zu der sogenannten Makuladegeneration. Die trockene Makuladegeneration ist eine Augenerkrankung, bei der Betroffene langsam ihre Sehkraft verlieren und Schritt für Schritt erblinden, ohne dass die Schulmedizin etwas dagegen tun kann. Bei der Entstehung dieser Erkrankung spielen vermutlich, wie so oft, oxidativer Stress und chronische Entzündungen eine wichtige Rolle.
Forscher aus Griechenland und den USA zeigten, dass einer Erblindung durch eine trockene Makuladegeneration mit nicht nur vorgebeugt werden kann. Die Sehkraft der fünfundzwanzig Studienteilnehmer verbesserte sich unter der Supplementierung sogar wieder.
Sogar bei Schlafstörungen gibt es hier Hinweise.
Eine wissenschaftliche Studie an mehr als 350 britischen Kindern, von denen fast die Hälfte Erblindung durch eine trockene Makuladegeneration mit Omega-3-Fettsäuren hatte, ergab, dass ein höherer Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im Blut dafür sorgte, dass die Kinder besser schlafen konnten.
Schutz vor Alzheimer
Eine Studie mit 1600 Testpersonen zeigte, dass diese Personen durch eine regelmäßige Zufuhr der wichtigen Fettsäuren geistig reger wurden. Neue Forschungen weisen sogar darauf hin, dass die Fettsäuren zu erhöhtem Schutz vor Alzheimer beitragen.
Die Verbesserung der Konzentration sowie Denk- und Merkfähigkeit ist bereits eindeutig bewiesen. Ebenso tragen DHA und EPA zu einer Verbesserung der Stimmung bei, vielleicht vergleichbar mit der Wirkung von Antidepressiva.
Quelle:
Prävention durch Omega 3 - zentrum-der-gesundheit.de
Sooo...
und damit haben wir nun auch den Bereich "Wofür benötigt der Körper die Fette und wie wirken sie?" gut abgedeckt.
Sie sehen also, ich halte hier eine bestimmte Reihenfolge Zuerst haben wir uns angeschaut was passiert wenn Fette in Ihren Körper über die Nahrung kommen, bzw. wie diese Fette dann verdaut werden. Dabei sind wir dann auch wieder auf das Thema "Cholesterin" gekommen, da bei der Fettverdauung einige bestimmte Fette eben mit den speziellen Transportproteinen durch den Körper geschleust werden. Hauptsächlich sind es ja die Langkettigen Fettsäuren. In dieser Fragestellung haben wir uns angeschaut was der Körper mit den kurzkettigen Fettsäuren macht und wofür er diese benötigt und wie diese wirken- Das gleiche haben wir dann auch mit den mittelkettigen Fettsäuren getan, und dann zum Schluss die Langkettigen Fettsäuren angeschaut. Dabei haben wir auch Unterscheiden zwischen den essentiellen Fette und den nicht-essentiellen Fetten.
Nachdem wir all das nun erfahren haben, kommt jetzt die nächste Frage in diesen Reihenfolge: Wie wird jetzt das Sättigungsgefühl bei den Fetten erreicht? Ja, denn tatsächlich weiß man das auch. In diesen Zusammenhang spielen nämlich zwei Hormone eine Rolle - einmal das sogenannte Leptin und das sogenannte Ghrelin. Vielleicht haben Sie schon einmal davon gehört?
Sättigungsgefühl und Hunger durch Leptin und Ghrelin
Hormone beeinflussen unsere Stimmung und können unseren Schlaf verbessern. Aber sie haben auch einen erheblichen Einfluss auf unseren Appetit und unser Essverhalten. An manchen Tagen ist der Appetit groß und an anderen überhaupt nicht. Hinter diesem Phänomen stecken komplexe Stoffwechselvorgänge, die vor allem durch die zwei Hormone Ghrelin und Leptin gesteuert werden.
--> Was ist Ghrelin?
Ghrelin ist das sogenannte "Hungerhormon". Ghrelin besteht wie Enzyme aus Aminosäuren. Es entsteht über mehrere Auf- und Abbaustufen in einem komplexen Syntheseweg unter dem Einfluss zahlreicher Enzyme.
Es regt unseren Appetit an und signalisiert dem Gehirn, dass es Zeit zum Essen ist. Es macht aber nicht nur Lust auf mehr Essen, sondern fördert auch die Fettspeicherung. Ghrelin wird im Magen produziert. Kleinere Mengen werden auch vom Gehirn, dem Dünndarm und der Bauchspeicheldrüse abgesondert.
Dieses Hormon hat zwar in erster Linie einen appetitanregenden Effekt, aber es ist auch an der Regulierung von Glukose und Insulin, dem Geschmacksempfinden und dem Schlaf beteiligt. Ghrelin fördert und steigert auch die Abgabe von Wachstumshormonen in der Hirnanhangdrüse (Hypophyse. Diese unterstützen den Stoffwechsel, bauen Körperfett ab und Muskeln auf.
Der Ghrelinspiegel schwankt im Laufe des Tages. Vor einer Mahlzeit steigt er hoch an und nach dem Essen sinkt er ab. Ghrelin wird ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist, gelangt ins Blut und wird darin bis zur Hirnanhangsdrüse des Gehirns weiterbefördert, wo es unsere Neuronen stimuliert um für Hungergefühle zu sorgen.
Diäten und Fasten können den Ghrelinspiegel ansteigen lassen. Wenn wir weniger Kalorien zu uns nehmen und dadurch Gewicht verlieren, steigt der Ghrelinspiegel deutlich an. Das könnte auch ein Grund sein warum klassische Diäten auf lange Sicht nicht so gut funktionieren. Tatsächlich findet man auch bei Menschen mit Magersucht erhöhte Ghrelinwerte.
Ebenfalls aber sinkt der Ghrelinspiegel im Blut nicht nur direkt nach einer Mahlzeit, sondern auch dann, wenn diese Mahlzeit ausbleibt, nach einigen Stunden wieder ab.
Bis heute findet die Wissenschaft immer weitere Ghrelin-Funktionen. Ghrelin beeinflusst - direkt oder indirekt - mindestens die folgenden Prozesse:
. Hunger, Appetit und Sättigung
- Fetteinlagerung
- Zuckerstoffwechsel und Insulin-Freisetzung
- Förderung der Freisetzung von Wachstumshormonen zum Muskelaufbau
- Schutzwirkung auf das Herz-Kreislauf-System durch anti-entzündliche Wirkung
- Einflussnahme auf Gedächtnisfunktion, Stressabbau und psychisches Gleichgewicht
- Förderung der Lungenreife beim Fötus
- Hemmung der Freisetzung des Sexualhormons Gonadotropin
Darüber hinaus gehen Wissenschaftler davon aus, dass Ghrelin beim Geschmacksempfinden und im Rahmen von Suchterkrankungen einen entscheidenden Beitrag leistet.
Nach der Freisetzung aus der Magenschleimwand gelangt Ghrelin über das Blut ins Gehirn und dockt dort im Hypophysenvorderlappen an spezielle Rezeptoren an.
Zugleich beeinflusst Ghrelin den Zucker- und Energiestoffwechsel sowie die Insulin- und Glukagon-Freisetzung. Auf diese Weise hemmt Ghrelin die Zuckeraufnahme und fördert die Bildung von Fettdepots. Eine Ghrelin-Störung und veränderte Ghrelin-Blutspiegel begünstigen deshalb womöglich eine Adipositas oder Magersucht.
Wobei es interessanterweise beobachtet wurde, dass bei Adipositas und stark übergewichtigen Menschen nicht wie erwartet der Ghrelin-Spiegel höher, sondern niedriger ist. Wissenschaftler gehen deshalb heute davon aus, dass das Hormon keine treibende Kraft für Adipositas ist, wohl aber für einen Fettaufbau bei normalgewichtigen Menschen. Diskutiert wird ferner, dass manche Menschen empfindlicher auf Ghrelin reagieren.
Endokrinologen nehmen mittlerweile an, dass Ghrelin bei Diäten für den Jo-Jo-Effekt sorgt: Während der Diät-Phase wird viel Ghrelin freigesetzt und der Körper geht in einen Notfallzustand. Wird wieder Nahrung zugeführt, so füllen sich die Fettdepots noch leichter wieder auf. Eine hochwertige, proteinreiche Kost dürfte diesem Ghrelin-Effekt entgegenwirken und Ghrelin beim Abnehmen einbinden.
Patienten, die unter dem Prader-Willi-Syndrom leiden, haben einen unnatürlich erhöhten Ghrelin-Spiegel und empfinden deshalb kein Sättigungsgefühl. Bei diesen Patienten sind Übergewicht und Adipositas Ghrelin-bedingt. Bei einer Magersucht ist Ghrelin in ähnlichen Blutspiegeln zu finden, was man auf den Notstand des Körpers zurückführen muss.
Gedächtnis, Schlaf und Depression: Ghrelin-Hormonwirkung mit Folgen
Die Forschung zeigt immer deutlicher, wie vielfältig die Auswirkungen des Ghrelin-Spiegels sind. Heute ist bekannt, dass auch der Wach-Schlaf-Rhythmus zu einem gewissen Maße vom Ghrelin abhängig ist, weil dieses die Freisetzung von Melatonin potenziell beeinflusst. Es lässt sich ferner nicht ausschließen, dass Ghrelin über seine Hormonwirkung direkt im Gehirn die Gedächtnisleistung, Merkfähigkeit und den Stressabbau herabsetzt. Der Zusammenhang von Ghrelin und Depressionen wird weiterhin wissenschaftlich untersucht, gilt aber als naheliegend.
Was erhöht den Ghrelin-Spiegel?
Wie gesagt: Beim Fasten steigt der Ghrelin-Spiegel rasant. Wer dem Hungergefühl nicht nachgibt, sorgt für eine vermehrte Freisetzung des Hormons mit all den unterschiedlichen Ghrelin-Wirkungen und Folgen.
Die Ghrelin-Diät: Was hemmt Ghrelin?
Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist eine gesunde, proteinreiche und ausgewogene Mischkost mit regelmäßigen Mahlzeiten die für eine normale Ghrelin-Funktion günstigste Ernährung. Gegen den kleinen Hunger zwischendurch sind eiweißreiche Snacks die beste Wahl. Kohlenhydrate und Proteine senken den Ghrelin-Spiegel schneller wieder als Fette.
--> Was ist Leptin?
Leptin ist das sogenannte "Sättigungshormon", und damit der Gegenspieler (Antagonist) von Ghrelin. Es wird hauptsächlich von den Fettzellen produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Appetits, indem es dem Gehirn signalisiert, wenn wir satt sind. Es hilft auch bei der Regulierung unseres Körpergewichts und Stoffwechsels. Kleine Mengen werden zudem im Knochenmark, der Skelettmuskulatur, der Magenschleimhaut und den Hautzellen produziert.
Weiterhin hat Leptin hat viele weitere Aufgaben im Körper, wie zum Beispiel die Regulierung des Fortpflanzungssystems. Außerdem hat es großen Einfluss auf das Immunsystem.
Leptin ist auch ein sogenanntes "Proteohormon"
Proteohormone und auch Peptidhormone sind lipidunlösliche/lipophobe (= fettunlösliche) Hormone, die eine Eiweißstruktur besitzen - also aus verbundenen Aminosäuren bestehen und durch Proteinbiosynthese entstehen. Es sind demnach spezielle Proteine, die Hormonfunktionen ausüben, also Botenfunktionen, die bestimmte Regelungen in tierischen, also auch menschlichen Körpern bewirken. Die meisten der Hormonarten sind Proteohormone.
Jedenfalls gibt Leptin an, wie satt Sie sich fühlen. Je höher der Körperfettanteil ist, desto mehr Leptin befindet sich im Körper. Sind im Körper also viele Fettzellen vorhanden, wird demnach viel Leptin ausgeschüttet - und anders herum. Dadurch wirkt es als Botenstoff um dem Gehirn den Energiezustand mitzuteilen. Leptin wird von den Fettzellen ins Blut abgegeben. Über die Leptinkonzentration im Blut sind so Rückschlüsse auf den Körperfettanteil möglich. Nachdem das Leptin die Blut-Hirn-Schranke passiert hat, wirkt es ebenfalls im Hypothalamus.
Dadurch werden auch noch weiterer appetitzügelnder Botenstoffe ausgeschüttet und die appetitsteigernde Hormone werden gehemmt. Hunger- und Sättigungsgefühle entstehen durch das Zusammenspiel verschiedener Substanzen. Auch die Magenfüllung bzw. -dehnung und Botenstoffe aus dem Magen-Darm-Trakt spielen dabei auch eine Rolle.
Leptin wirkt neben der Regulation des Hungergefühls noch an anderen Vorgängen im Körper mit, wie z. B.:
- Förderung der Glukoseverwertung
- Beeinflussung des Knochenaufbaus
- Steigerung von Blutdruck und Herzfrequenz
- Anregung der Bildung von Schilddrüsen- und Wachstumshormonen
- Einfluss auf Entzündungsprozesse und die Wundheilung
Es scheint also recht einfach. Wenn viel Fett gegessen wurde und vermehrt Leptin im Körper ist, dann sollte ein Mensch doch gar nicht mehr weiter essen müssen, oder? Doch wie kommt es, dass es Menschen gibt, die weit über das natürliche Sättigungslevel hinaus weiter essen und dadurch übergewichtig werden?
Die Leptinresitenz
Bei übergewichtigen Menschen hingegen funktioniert die Signalisierung des Sättigungsgefühls nicht mehr. Man spricht dann von einer Leptinresistenz. Trotz hoher Leptinspiegel, die aufgrund des hohen Fettgewebes im Körper vorhanden sind, empfinden Betroffene kein gesundes Sättigungsgefühl mehr - die Zellen des Gehirns werden nicht angesprochen. Die genaue physiologische Entwicklung der Leptinresistenz bei Menschen mit Adipositas ist bisher nur unzureichend erforscht.
Wissenschaftler vermuten, dass ein gestörter Leptintransport ins Gehirn oder eine Funktionshemmung der Rezeptoren dafür verantwortlichen sein könnte. Auch eine Ernährung, die reich an Fett oder Zucker ist, kann die Leptinwirkung beeinträchtigen
Eine Leptinresistenz führt dazu, dass der Mensch mehr isst, als der Körper braucht, was das Übergewicht weiter verschlimmert. Dies kann zu Schäden am Herz-Kreislauf-System und am Bewegungsapparat führen. Auch das Risiko für Diabetes ist erhöht. Ein zu hoher Leptinspiegel kann zudem Entzündungsprozesse fördern. Eine ausgewogene Ernährung kann die Leptinempfindlichkeit verbessern und gesundheitlichen Schäden vorbeugen.
Es gibt einige Faktoren, die Sie beachten können um den Leptinspiegel zu erhöhen.
Um Ihren Leptinspiegel zu regulieren, finden Sie hier 4 Tipps, die Ihnen helfen können.
- Gesunde Ernährung und Achtsam essen
Um einen korrekten Leptinspiegel zu erreichen, ist es ratsam, ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen, wie Getreide, Hülsenfrüchte oder Haferflocken.
Es wird auch empfohlen, die Aufnahme von Kohlenhydraten, die vor allem in verarbeiteten Produkten enthalten sind, zu reduzieren. Wählen Sie Kohlenhydrate, die in Obst und Gemüse enthalten sind.
Proteine machen satt und geben Ihnen Energie für den ganzen Tag. Sie können sie zum Frühstück zu sich nehmen. Omega 3 trägt dazu bei, die Leptinempfindlichkeit zu erhöhen.
Langsam zu essen ist ebenfalls besser. Nicht nur ist es eh gesünder, sondern unterstützt auch beim Abnehmen. Man fühlt sich schneller satt. Auch die Reaktion des Appetithormons wird dadurch verbessert. Wenn Sie sich die Zeit zum Genießen nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie mehr essen, als Sie brauchen.
- Reduzieren Sie den Stress
Es ist allgemein bekannt, dass Stress ein hormonelles Ungleichgewicht verursacht. Leider ist Leptin eines dieser Hormone! Wenn Sie sich in einer stressigen Situation befinden, riskieren Sie Verdauungsprobleme und eine Störung des Sättigungsgefühls. In diesem Fall ist es wichtig, einen Weg zu finden, den Stress abzubauen, um den idealen Leptinspiegel wieder zu erreichen.
- Bauen Sie Ihre Muskelmasse auf
Körperliche Betätigung hat viele Vorteile. Die Leptinempfindlichkeit kann erhöht werden, wenn Sie aktiv sind. Man verbrennt nicht nur Kalorien, sondern fühlt sich auch satt. Es ist auch eine Lösung gegen Stress, denn mehrere Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Sport treiben, weniger Stress haben. Auch Studien an Mäusen konnten zeigen, dass die Leptinresistenz durch mehr Bewegung sich wieder zurückbildete.
- Genießen Sie einen erholsamen Schlaf
Der Schlaf wirkt sich auf viele Funktionen des Körpers aus. Das gilt auch für den Leptinspiegel. Wenn der Körper ruht, lädt er Leptin in gewisser Weise wieder auf. Wer hat sich nicht schon einmal nach einer schlechten Nacht hungrig gefühlt? Wenn Sie 8 Stunden pro Nacht schlafen, erhöht sich Ihre Chance, den Spiegel des Sättigungshormons zu regulieren.
Es ist also wichtig ein Gleichgewicht dieser beiden Hormone - Leptin und Ghrelin - zu halten. um ein gesundes Körpergewicht zu halten. Ein Ungleichgewicht dagegen kann zu einer deutlichen Gewichtszunahme oder -Abnahme führen und wurde auch mit Ess- und Stimmungsstörungen in Zusammenhang gebracht.
Ok...
.. damit hätten wir also die Fettaufnahme, Verdauung und Funktion der Fette nun umfassend erklärt. Doch eine kleine Sache, die ich zwar schon in den oberen Texten an manchen Stellen angedeutet habe, aber noch nicht richtig drauf eingegangen bin, aber dennoch erwähnenswert ist, sollte ich vielleicht auch eben kurz ansprechen.
Fette als Schutz für Organe und die Haut
Die Fette werden nämlich nicht nur die Körperfunktionen benötigt, sondern Fette dienen auch als Schutz für die Organe und vor mechanischen Beanspruchung. Denn wie Sie ja nun mehrfach gelesen haben, wird Fett ja auch in den Zellmembranen gespeichert, bzw. auch teilweise um die Organe herum. Beispielsweise wird um das Herz oder die Nieren und das Nervensystem auch zu einem gewissen Teil mit Fettgewebe umhüllt. Hauptsächlich handelt es sich bei diesen Fetten hier um die Langkettigen Fettsäuren. Solange der Fettanteil im richtigen Maß ist, ist alles in Ordnung und auch wichtig. Denn dort bietet das Fett ja eben mechanischen Schutz. Und das Fett in der Unterhaut dient aber auch als Isolierung vor Kälte und Wärme.
Tatsächlich also gibt es zwei Arten von Fett: Einmal das Subkutane Fett, auch Unterhautfettgewebe genannt, und das Viszeralfett.
Subkutanes Fett
Das subkutane Fett befindet sich direkt unter der Haut und überdeckt die Bauchmuskeln - es dient der Isolation gegen Kälte und Wärme. Dieses Fett entsteht als Folge eines Kalorienüberschusses: Unser Körper speichert die überschüssige Nahrungsenergie zunächst in Form von subkutanem Fett, um später darauf zuzugreifen. Was für unsere Vorfahren überlebensnotwendig war, führt bei uns modernen Menschen oft zu unerwünschten Speckröllchen.
Viszerales Fett
Das Wort Viszeralfett kommt von lateinisch viscera, was "die Eingeweide" bedeutet. Eine andere Bezeichnung ist "intraabdominales Fett". Dies bezeichnet das bei Wirbeltieren in der freien Bauchhöhle eingelagerte Fett, das die inneren Organe, vor allem des Verdauungssystems, umhüllt. Es ist im Gegensatz zum Unterhautfettgewebe nicht sichtbar.
Steigt der Kalorienüberschuss, lagern sich weitere Fettdepots im Bauchraum an und werden dann eben als das sogenannte viszerale Fett unter der Bauchmuskeldecke in der Bauchhöhle gespeichert. Auch hier ist ein gewisses Maß natürlich und gesund, denn es umgibt und schützt Organe wie etwa die Leber oder den Darm und dient als Energiereserve. Aber: Viel viszerales Fett hat negative Folgen für die Gesundheit.
Ab einer gewissen Menge Viszeralfett ist das Bauchvolumen sichtbar vergrößert. Dadurch entsteht der vorstehende Bauch, was wir als nicht so schön empfinden. Auch deswegen, weil eine vergrößerter Bauchumfang auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
Als Maß für das Viszeralfett dient daher der Bauchumfang. Man misst diesen zwei Querfinger oberhalb der Oberkante des Beckenkamms.
Messen sollte man vor dem Frühstück, also am besten im nüchternen Zustand. Außerdem während man steht, am freien Oberkörper, beim ausatmen.
Für die Berechnung von Übergewicht ist zwar nach wie vor der Body-Mass-Index (BMI) verbreitet. Diese Kennzahl lässt allerdings wichtige Gesundheitsfaktoren außer Betracht, denn sie errechnet sich allein sich aus Körpergewicht und Körpergröße (Gewicht geteilt durch Größe zum Quadrat). Beispiel: Ist eine Frau 75 Kilo schwer und 1,69 Meter groß, dann hat sie einen BMI von 75 : (1,69 x 1,69) = 26,3 und damit Normalgewicht. Ob die Frau Bodybuilding macht und Muskelpakete besitzt, ob sie besonders kurvig ist oder ob sie als "Apfeltyp" hauptsächlich Körperfett im Bauchraum speichert: Für ihre Gesundheitsprognose macht das einen enormen Unterschied. Inzwischen geht man deshalb davon aus, dass der Bauchumfang für das individuelle Risiko aussagekräftiger ist als der BMI.
Welche Werte sind im Normalbreich, und ab wann wird es gesundheitsschädlich?
Bei Frauen besteht ab einem Bauchumfang von 80 cm, bei Männern von 94 cm ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sowie für Diabetes mellitus Typ 2. Ab einem Bauchumfang von 88 cm (Frauen) bzw. 102 cm (Männer) gilt das Risiko sogar als stark erhöht.
Der Bauchumfang erlaubt damit eine orientierende Abschätzung der statistischen Risikoerhöhung durch Übergewicht und schweres Übergewicht (Adipositas), die mit dem Verhältnis von Bauch zu Hüfte gut korreliert. Der erst seit Juli 2012 existierende Body-Shape-Index (BSI oder auch ABSI) soll besser als der Body-Mass-Index (BMI) Gesundheitsrisiken prognostizieren, indem er das besonders schädliche Bauchfett mit in die Berechnung einbezieht.
Doch warum ist das so? Warum wird durch ein vergrößerte Bauchumfang die Gesundheit geschadet?
Nun, die Sache ist die, dass in diesem vermehrten Fettgewebe eine hohe hormonelle Aktivität herrscht. Viszerales Bauchfett kann unter anderem die Freisetzung von entzündungsfördernden Hormonen und Substanzen steigern und das Immunsystem schwächen. Die Folge ist eine chronische Entzündung im Körper. Beispielsweise findet eine hohe hormonellen Aktivität in den sogenannten Adipozyten statt. Diese Fettzellen speichern nicht nur Fett, sondern produzieren auch Leptin, Resistin und Adiponektin.
Menschen mit zu viel Bauchfett leiden zudem häufig unter Bluthochdruck und haben ein gesteigertes Risiko für Herzkrankheiten und Typ-2-Diabetes. Die Anlagerung von viszeralem Bauchfett kann außerdem Folgeerkrankungen wie Arthrose, Schlaganfälle oder eine Fettleber verursachen.
Um das mal zu verdeutlichen gehen wir mal eben etwas genauer auf das bekannte Beispiel der Fettleber ein.
Die Leberverfettung ist eine Zivilisationskrankheit, ihre Ursachen liegen großenteils in der Lebensweise: eben falsche Ernährung - besonders zu viele isolierte) Kohlenhydrate und schlechten Fetten (dazu komme ich gleich) - und mangelnde Bewegung. Übergewicht, aber auch Alkoholmissbrauch und bestimmte Medikamente begünstigen die Krankheit.
Diese Krankheit kann über Jahre völlig unbemerkt verlaufen. Die Leber lagert Fett ein und schwillt an - in schweren Fällen bis auf die doppelte Größe. Doch das Organ leidet im Verborgenen. Die Belastung der Leber zeigt sich allenfalls durch Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Selbst die sogenannten Leberwerte (GOT, GPT) geben bei einer Blutuntersuchung im ersten Stadium noch keinen Hinweis. Erst wenn die Fettleber sich entzündet, steigen die Leberwerte an, und es treten mitunter Symptome einer Gelbsucht auf. Da eine verfettete Leber ihren Aufgaben bei der Stoffwechselkontrolle nicht mehr richtig nachkommen kann, entgleisen allmählich die Blutzucker- und Blutfettwerte.
Wenn das vermehrte Fett im Laufe der Zeit zu einer Entzündung der Leber führt, drohen schwerwiegende Folgen: Das Lebergewebe kann sich verhärten, vernarben und schließlich sogar zu einer Leberzirrhose - einer Wucherung, die letztendlich zu narbiger Schrumpfung und dem Verlust des Funktionsgewebes führt - entwickeln
Doch eine Fettleber kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Dazu bedarf es eine Ernährungsumstellung. Eine gesunde Ernährung und Lebensweise ist hier wichtig. Auch ist das sogenannte "Intervallfasten" eine gute Idee überschüssige Kilos loszuwerden. Denn beim Intervallfasten wird der Körper nur stundenweise oder für einzelne Tage auf Energie-Entzug gesetzt. Dadurch schaltet er auf Fettverbrennung, statt den Grundumsatz zu drosseln. Kombiniert man das Ganze dann noch mit etwas Sport (was aber nicht zwangsweise nötig ist), kann man den Abnehm-Erfolg noch etwas weiter erhöhen. Doch wie das alles mit dem Abnehmen und der Fettverbrennung, das Zusammenspiel mit dem Kohlenhydrate, genau funktioniert, erkläre ich im dritten Teil dieser Serie.
Also, nun wissen Sie also wie der Fettstoffwechsel funktioniert, was es für Fette gibt und welche für unsere Ernährung wichtig sind und warum. Doch leider ist es auch so, dass es auch "schlechte" Fette gibt, die sich vor allem in industriell verarbeitete Nahrungsmittel befinden. Und das sind die sogenannten "Transfette".
Das Thema "Transfette" habe ich ja auch schon im ersten Teil dieser Serie kurz erwähnt. Nun wird es also Zeit einen genaueren Blick auf diese Fette zu werfen.
Schlechte Fette, die Ihrer Gesundheit schaden
Erinnern Sie sich noch was Transfette sind, bzw. warum sie so benannt werden?
Wie Sie ja noch wissen, gibt es einen Unterschied zwischen gesättigten und ungesättigten Fetten. Die gesättigten Fettsäuren haben immer eine vollständige Reihe von einfach gebundenen C-Atomen, an denen immer (außer an den beiden äußeren Paaren) 2 H-Atome dran hängen. Bei den ungesättigten Fettsäuren sind irgendwo in der Kette mindestens 2 C-Atome über eine Doppelbindung verbunden. Dadurch bleiben bei diesen beiden C-Atomen nur noch jeweils 1 "Arm" übrig, an dem 1 H-Atom dran hängt.
Also so:
H H H
| | |
-- C = C -- C
|
H
Sie sehen also das da ein C-Atom mit den nächsten C-Atom mit einer Doppelbindung verbunden ist (C=C). Folglich dessen können hier nur noch 1 H-Atom an diesen beiden C-Atome dran hängen. Denn C-Atome sind ja 4 wertig. Mehr wie 4 Atome können da nicht dran hängen. Durch diese andersartige Verbindung an dieser Stelle, entsteht bei dem Molekül an dieser Stelle ein Knick. Die Kohlenwasserstoffkette "biegt" plötzlich "ab". Deswegen zeichnet man diese Kette an dieser Stelle auch so schief, um das zu verdeutlichen.
Also so:
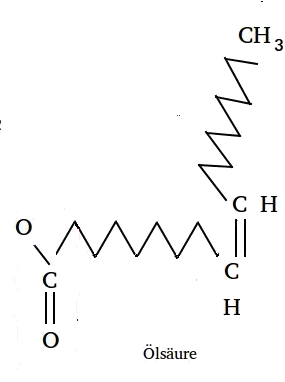
Transfettsäuren sind nun auch immer ungesättigte Fettsäuren. Sie haben also auch eine oder mehrere Doppelbindungen. Diese Doppelbindungen sind hier aber nicht "normal", sondern diese Bindungen sind an dieser Stelle "gestört". Diese Störung führt dazu das die Doppelbindung sich so verdreht, dass sie trotzdem nicht geknickt sind - also genauso (oder ähnlich) als gerade Kette aussehen wie eine gesättigte Fettsäure. Somit haben wir also eine Art "Zwischending" zwischen gesättigter und ungesättigter Fettsäure. Daher auch "Trans-Konfiguration" oder "TRANS-Fettsäuren". Und diese Konstellation, diese unnatürliche Veränderung in der Molekülkette, führt dann dazu das diese Fettsäure eine äußert schädliche Wirkung auf den Körper haben. Diese Fettsäuren gilt es also zu meiden.
Denn geknickte Fettsäuren sind ideal, denn sie werden - wenn wir etwas Fetthaltiges essen - in unsere Zellmembranen (die u. a. aus Fettsäuren bestehen) eingebaut und verleihen gerade durch ihre Knicks den Membranen eine gesunde und wichtige Elastizität.
Werden nun aber die kerzengeraden Transfettsäuren verzehrt, dann werden auch diese in die Zellmembranen eingebaut. Dadurch verlieren die Zellmembranen ihre Elastizität und damit auch ihre Funktionstüchtigkeit.
Doch wie genau entstehen diese Fette und wo sind diese zu finden?
Transfette (auch Transfettsäuren genannt) sind insbesondere in industriell stark verarbeiteten Produkten enthalten: in Pommes, Chips, Berlinern und Blätterteig, Fertigsuppen, Bratensaucen, Wurst und selbst in Müsli.
Transfette entstehen außerdem, wenn Öl beim Braten und Frittieren zu stark erhitzt wird und sie kommen natürlicherweise in Milchprodukten und Fleisch vor.
Industrielle Transfette durch Härtung von Fetten
Transfette entstehen etwa bei der industriellen Härtung von Pflanzenfetten (der sogenannten Hydrierung). Bei der Fetthärtung verändert sich die Struktur des Fettes von flüssig, zu streichfähig zu fest. Werden Fette nur teilgehärtet, also streichfähig gemacht, entstehen Transfette. Werden Fette dagegen komplett durchgehärtet, sinkt der Anteil der Transfettsäuren gegen Null.
Bevor die gesundheitlichen Risiken von Transfetten untersucht wurden, hat man Fette für Margarine, Nuss-Nougat-Cremes und Co. meistens teilgehärtet. Seit man über die schädlichen Wirkungen der Transfette Bescheid weiss, ist die Lebensmittelbranche jedoch vermehrt auf durchgehärtete Fette umgestiegen. Dadurch ist der Transfettgehalt in Fertigprodukten in den letzten Jahren gesunken.
Transfette entstehen bei der Ölverarbeitung
Auch bei der Verarbeitung raffinierter Pflanzenöle können sich Transfette bilden. Bei der sogenannten Desodorierung wird das Öl mit bis zu 250 Grad heissem Wasserdampf erhitzt, um unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe zu entfernen. Dadurch entstehen zwischen 0.5 und 1.5 % Transfettsäuren in raffinierten Ölen, was nicht viel ist. Kaltgepresste und native Öle werden nicht desodoriert und enthalten folglich auch kaum Transfettsäuren (weniger als 0.1 %).
Verwendet man ein ungeeignetes Öl zum Braten und Frittieren (z.B. kalt gepresstes Sonnenblumenöl), können auch dadurch Transfette entstehen. Denn nicht jedes Öl verträgt hohe Temperaturen. Entscheidend ist der Rauchpunkt, also der Punkt, ab dem Öle beginnen zu rauchen und sich zu zersetzen.
Am hitzestabilsten sind Kokosfett und ölsäurereiches Sonnenblumen- sowie Rapsöl ("High-Oleic-Öle"). High-Oleic-Sonnenblumenöl und High-Oleic-Rapsöl vertragen durch die Züchtung spezieller Pflanzensorten Temperaturen bis 210 Grad. Beim Frittieren entstehen in der Regel Temperaturen bis 180 Grad, beim Braten bis 200 Grad.
Ebenfalls bilden sich Transfettsäuren, wenn Öle mehrfach erhitzt werden. Denn kühlt das Öl ab und wird erneut erhitzt, zersetzt es sich stärker. In Sonnenblumenöl erhöhte sich der Transfettgehalt vom ersten zum zweiten Mal Frittieren bei 190 Grad auf das Doppelte (von 0.12 auf 0.24 %).
Natürliche Transfette in tierischen Produkten
Transfette bilden sich aber auch auf natürliche Weise im Verdauungstrakt von Wiederkäuern wie Kühen, Schafen und Ziegen. Dort werden die ungesättigten Fettsäuren aus deren Nahrung von Mikroorganismen in Transfettsäuren umgewandelt. Diese Transfettsäuren nimmt der Mensch dann wiederum mit dem Verzehr von Milchprodukten und Fleisch auf. Das Fett aus Fleisch, Milchprodukten besteht zu 2 bis 3 Prozent aus Transfetten.
Lange Zeit wurde vermutet, dass natürliche Transfette, die im Verdauungstrakt von Wiederkäuern gebildet werden, weniger schädlich sind als Transfette, die bei der Verarbeitung von Nahrungsmitteln entstehen. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass dem nicht so ist.
Hier nun mal eine Liste, wo Transfette überall enthalten sind:
- Fertigprodukte und Fertiggerichte (z. B. Fertigpizza, Fischstäbchen, Trockensuppen)
- Backwaren wie Croissants, Donuts, Berliner, Blätterteig-Gebäck usw.
- Fast Food und Frittiertes (z. B. Pommes Frites, Chicken Wings)
- Süssigkeiten
- Salzige Snacks: Chips, Popcorn, Flips usw.
- Aufstriche: Margarine, Nuss-Nougat-Creme, Erdnussbutter usw.
- Streichfähige Saucen und Dips (z. B. Mayonnaise, Remoulade)
- Milchprodukte: Butter, Milch, Joghurt, Milchschokolade
- Fleisch von Wiederkäuern: Kühe, Schafe, Ziegen etc.
- Müsli und Müsliriegel
- Ghee (Butterschmalz)
Quelle: ZDG - Transfette
Festgelegte Grenzwerte der Transfette
Aufgrund gesundheitlicher Warnungen vor Transfetten in der Vergangenheit hat die EU seit April 2021 eine Obergrenze für Transfette von 2 % pro 100 g Fett in industriellen Lebensmitteln festgelegt.- also 2 Gramm pro 100 g Fett. Zuvor galt bloss ein Grenzwert von 3 % für Säuglingsnahrung und Olivenöl.
Die WHO empfiehlt hingegen, weniger als 1 % der täglichen Energie aus Transfetten aufzunehmen. Das entspricht bei 2000 Kalorien täglich einer Obergrenze von 2.2 Gramm Transfetten.
Lediglich die Deklarationspflicht mit der Aufschrift "enthält teilgehärtete / gehärtete Fette" bot zuvor einen Anhaltspunkt). Dem Verbraucher ist es aber trotzdem kaum möglich abzuschätzen, ob er die von der WHO empfohlene 1-Prozent-Grenze überschreitet oder nicht.
Wie viele Transfette nehmen wir zu uns?
Es wäre interessant das zu wissen, doch leider sind keine aktuellen Zahlen zur Transfettaufnahme der Bevölkerung zu finden. Die Frage, die sich stellt, ist ob denn die Bemühungen der Lebensmittelhersteller und die Obergrenze der EU etwas positives bewirkt haben.
Laut einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung von 2013 sei die Aufnahme an Transfettsäuren in Deutschland unbedenklich, denn sie läge bei nur 1.6 g pro Tag bzw. 0.66 % der Gesamtenergie - also unter der Empfehlung der WHO. Lediglich 10 % der Bevölkerung würden sich so ernähren, dass sie zwischen 1 und 2 % der Nahrungsenergie über Transfette aufnähmen.
Das Bundesinstitut schreibt jedoch selbst, dass die Daten, auf der diese Einschätzung beruht, sehr uneinheitlich seien, da pro Lebensmittelart teilweise sehr hohe, teilweise wiederum sehr niedrige Transfettgehalte gemessen wurden. Auch flossen unter anderem Frittieröle und industrielle Backzutaten nicht in die Einschätzung mit ein - also eben genau die Zutaten, für welche die Transfette in der Bäckerei, am Imbissstand oder im Restaurant nicht deklariert werden.
Die Altersgruppe mit dem höchsten Transfett-Verzehr sei laut einer Untersuchung die der 15- bis 35-Jährigen.
Zum selben Schluss kam das Bundesinstitut für Risikobewertung: Rund 36 % der 19- bis 24-jährigen Männer würden mehr als 1 % ihrer Nahrungsenergie aus Transfetten aufnehmen - unter den 25- bis 34-jährigen Männern seien es rund 28 %. Bei den Frauen seien es 22 % bei den 19- bis 24-jährigen und 16 % bei den 25- bis 34-jährigen.
Im Landesvergleich stand Deutschland wiederum nicht schlecht da: In der TRANSFAIR-Studie von 1999 wurden für Deutschland 2.2 Gramm Transfette pro Tag gemessen. Spitzenreiter waren damals die USA mit 8.1 bis 12.8 Gramm und die Niederlande mit 10.0 bis 17.4 Gramm. Niedriger war der Gehalt dagegen rund um das Mittelmeer mit 1.5 Gramm in Spanien und 1.7 Gramm in Italien.
Wie ungesund müsste man sich ernähren um viel Transfette aufzunehmen?
Würde man beispielsweise zum Frühstück ein Croissant essen, zum Mittagessen einen Hamburger, zum Abendessen ein Wiener Schnitzel und danach je ein Drittel einer Packung Chips und einer Packung Kekse, hätte man etwa 1 Gramm Transfette zu sich genommen.
Man müsste sich also schon sehr ungesund ernähren, um mehr als die von der WHO empfohlene Obergrenze von 1 % seiner täglichen Energie aus Transfetten aufzunehmen.
Warum werden Transfette in der Lebensmittelproduktion verwendet?
Mit der Erfindung von teilweise hydrogenisierten Fetten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden Transfette erstmals gezielt in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Sie werden verwendet, um Lebensmittel und Öle länger haltbar zu machen und um ihre Textur zu verändern, einen Brotaufstrich beispielsweise streichfähig zu machen. Ausserdem sind hydrogenisierte Öle kostengünstiger als tierische Fette.
Doch eben aufgrund von mehreren Studien, die gegen Ende des letzten Jahrhunderts herausgekommen sind und gezeigt haben wie schlecht diese für die Gesundheit sind, haben einige Länder daraufhin eine Obergrenze festgelegt.
Welche gesundheitlichen Gefahren gehen von Transfetten aus?
Die WHO schätzt, dass 2010 weltweit mehr als 500.000 Personen an den Folgen von zu viel Transfettsäuren in der Ernährung gestorben sind. Denn Transfette erhöhen das Risiko für viele Erkrankungen. Die folgenden negativen Auswirkungen von Transfetten auf die Gesundheit wurden bisher identifiziert:
- Sie verschlechtern die Cholesterinwerte
- Sie erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen
- Sie fördern Entzündungen, die an der Entstehung von Krankheiten, wie etwa Herzinsuffizienz, Depressionen, Alzheimer, Rheuma, Schuppenflechte, Krebs, sowie chronischen Darmentzündungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, beteiligt sind
- Transfette erhöhen Risiko für Depressionen
- Sie erhöhen das Risiko für Prostata- und Dickdarmkrebs
- Transfette verschlechtern das Gedächtnis
- In der Schwangerschaft können sie das Geburtsgewicht des Babys reduzieren
- Sie könnten den Testosteronspiegel senken und die Spermienqualität verringern
- Sie fördern Akne
Es ist ausserdem zu bedenken, dass Transfette häufig aus Fertigprodukten stammen, also oft noch alle möglichen Geschmacks- und Konservierungsstoffe sowie Zucker enthalten, was sich zusätzlich negativ auf die Gesundheit auswirkt.
Natürliche Transfette sind ebenfalls schädlich
Lange wurde vermutet, dass sich nur industrielle Transfette negativ auf die Gesundheit auswirken. Doch eine Studie, die im American Journal of Clinical Nutrition erschienen ist, fand heraus, dass sich natürliche Transfette ebenfalls schädlich auf den Cholesterinspiegel und die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirken.
Wenn man sich aber grundsätzlich gesund ernährt und hin und wieder etwas Butter oder Margarine auf sein Brot schmiert, dann werden diese Transfettsäuren kaum schaden. Ernährt man sich aber größtenteils von tierischen Produkten und Fertiggerichten, sieht die Sache natürlich anders aus.
Margarine: Kaum Transfette mehr
Zwar hat es in der Vergangenheit schon Lebensmittelproduzenten gegeben, die bereits frühzeitig auf die Gefahren durch Transfette reagiert haben. Besonders die Margarine litt unter dem schlechten Ruf der Transfette. Überhaupt gab es immer wieder Kritik was die Herstellung von Margarine angeht. Letztendlich bedurfte es aber der öffentlichen Kritik, um die Lebensmittelindustrie zum Umdenken zu bewegen. Dies hat dazu beigetragen, dass nach Alternativen gesucht wurde, die keine Gesundheitsgefährdung mit sich bringen. Die Hersteller haben dann angefangen komplett durchgehärtetes Pflanzenöl mit flüssigem Pflanzenöl zu mischen, so dass sich daraus eine streichfähige Konsistenz ergibt. Margarine, die auf diese Weise hergestellt wurde, enthält so gut wie keine Transfette. So sank in Deutschland der Transfettgehalt in Margarine von durchschnittlich 22 % im Jahr 1994 auf 1.8 % im Jahr 2008.
Transfette vermeiden
Obwohl unsere Ernährung heute viel weniger Transfette enthält als noch vor 10 bis 15 Jahren, sollten Transfette dennoch bestmöglich gemieden werden. Wenn Sie die folgenden Punkte beachten, können Sie Ihre Transfettaufnahme weiter reduzieren:
- Bereiten Sie Ihr Essen frisch zu und verzichten Sie auf Fertigprodukte, Fast Food usw.
- Achten Sie beim Einkaufen auf Hinweise wie "enthält gehärtete / teilweise gehärtete Fette" und meiden Sie die jeweiligen Produkte.
- Frittieren Sie nur noch in der Heissluftfritteuse, denn dabei kommt viel weniger oder gar kein Fett zum Einsatz als in herkömmlichen Fritteusen.
- Achten Sie bei Ölen auf die Erhitzbarkeit und setzen Sie beim Braten und Frittieren auf Kokosöl, High-Oleic-Sonnenblumenöl oder High-Oleic-Rapsöl. Raffiniertes Erdnussöl lässt sich zwar bis zu einer Temperatur von 230 Grad erhitzen, jedoch enthält es wie oben beschrieben vielfach bereits durch die Raffination Transfette. Nicht raffiniertes Erdnussöl lässt sich wiederum nur bis 170 Grad erhitzen.
- Je mehr gesättigte Fettsäuren ein Pflanzenöl enthält, desto hitzestabiler ist es. Das bedeutet, dass Sie es zum Braten nehmen können, ohne dass sich Transfettsäuren bilden.
- Je mehr ungesättigte Fettsäuren ein Pflanzenöl enthält, desto empfindlicher ist es. Das bedeutet, dass Sie es nur für die kalte Küche verwenden oder nach dem Kochen über die Speisen geben können.
- Beginnt Öl beim Braten zu rauchen, sollten Sie es nicht weiter verwenden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es sich zersetzt hat. Dadurch entstehen dann sehr hohe Oxidationsprozesse, die im Körper freie Radikale auslösen. Außerdem entsteht dabei der sehr giftige Stoff Acrolein
- Erhitzen Sie Öl nicht mehrmals.
- Setzen Sie auf eine gesunde, vitalstoffreiche Pflanzenkost mit möglichst wenig industriellen Lebensmitteln.
So, nun wissen Sie also auch über die Transfette bescheid. Der vollständigkeit-halber sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es auch noch große Unterschiede bei den industriell hergestellten Ölen gibt. Denn auch hier gibt es Öle, die alles andere als gesund sind. Und das sind die
Raffinierten Speiseöle
Was sind raffinierte Öle?
Diese Kategorie von Fetten sollten Sie besser ebenfalls meiden. Hierbei sind diese - meiste auch sehr preisgünstigen - Öle gemeint, die in durchsichtigen Plastikflaschen verkauft werden. Diese gibt es als Sonnenblumenöl, Rapsöl und Olivenöl. Wobei, im Grunde ist es fast schon egal ob Sie Sonnenblumenöl nehmen, oder Rapsöl. All diese billigen Öle sehen sowieso gleich aus und schmecken auch fast gleich. Das liegt eben genau daran, dass sie raffinioert werden.
"Raffination" bedeutet "industrielle Weiterverarbeitung". Es handelt sich hier also um ein sehr stark verarbeitetes Produkt. Im konventionellen Bereich ist dieser Vorgang der Raffination von pflanzlichen Ölen aufwändig und besteht aus einem langwierigen Verfahren, bei dem das Öl zunächst mit heißem Wasser, Dampf oder Säuren entschleimt, dann durch hohe Temperaturen oder mithilfe von Laugen entsäuert und nach dem Bleichen desodoriert wird. Das Ergebnis ist ein nahezu farbloses, klares, recht geschmacksneutrales aber relativ hitzebeständiges Öl, was anschließend mit Aroma, Vitaminen und Farbstoffen wieder "aufgehübscht" werden darf. Mit "natürlich" hat das Öl danach nichts mehr zu tun, zumal bei der Raffination ebenfalls Trans-Fettsäuren entstehen können.
Im Bio-Bereich werden Öle nur mit Wasserdampf behandelt, um dadurch ungesättigte Fettsäuren in gesättigte Fettsäuren umzuwandeln und das Öl somit höher erhitzbar zu machen. Dabei gehen auch einige Aromastoffe verloren. Eine Ausnahme bildet das Olivenöl, welches laut EU-Norm zwar genauso mit Wasserdampf behandelt werden kann, sich dann aber "raffiniert" nennen muss.
Quelle: utopia.de - Speiseöle
Herstellung von raffinierten Ölen - und warum sie gesundheitsschädlich sind
Gehen wir das Herstellungsverfahren mal nacheinander durch um zu schauen wo hier das Problem liegt.
Da es ja die sogenannten "kaltgepressten" Öle gibt (die in den dunklen Flaschen), muss es ja wohl auch eine Heißpressung eben. Und genau das wird bei diesen Ölen gamacht. Jedoch gibt es neben der Heißpressung auch noch das Extraktionsverfahren. Abhängig von den Verarbeitungsverfahren können bei der Ölproduktion riskante Schadstoffe entstehen, für die die EU bereits auch in Ölen zum unmittelbaren menschlichen Verzehr Höchstgehalte eingeführt hat. Fakt ist, dass Herstellungsprozesse, in denen hohe Temperaturen erforderlich sind mit mehr Schadstoffen belastet sein können.
Wie schon bei den Transfetten gesagt, ist das so, dass wenn man ein nicht hitzestabiles Öl im falschen Temperaturbereich erhitzt, dieser dann sein individuellen Rauchpunkt überschreitet und dadurch dann Dämpfe mit gesundheitsschädlichen Substanzen entstehen.. Diese Dämpfe gelangen dann über den Verzehr oder über die Atemluft in den Körper. Durch zu hohe Öltemperaturen ab 150 Grad Celsius entstehen in den Verbrennungsprozessen zahlreiche schädliche Substanzen.
Zur Herstellung von Speiseöl durch Heißpressung werden im ersten Schritt Früchte, Samen oder Kerne von Pflanzen zerkleinert oder gemahlen und nach dem Erhitzen mit hohem Druck ausgepresst.
Die dabei entstehenden Temperaturen betragen zwischen 100 und 170 °C. Das Öl, das in dem Presskuchen verblieben ist, wird mit Lösungsmitteln wie Benzol oder Hexan extrahiert. Zur Trennung wird das Gemisch auf bis zu 140 °C erhitzt.
Im Anschluss erfolgt die mehrstufige Raffination des Rohöls, das in der Regel trübe, dunkel und mit störenden Geschmacksstoffen belastet ist. Auch die Raffination, die das Speiseöl entsäuert, entfärbt und mit Hilfe von Wasserdampf von unerwünschten Geruchs- und Geschmacksstoffen befreit, erfolgt unter hohen Temperaturen. Durch diesen Raffinationsprozess werden dann ja auch die gesundheitlich wertvolle ungesättigte Fettsäuren, sekundäre Pflanzenstoffe und Eiweiße aus dem Speiseöl entfernt. Gleichzeitig erhöht sich bei diesem "neu gewonnenen" Öl nun der Rauchpunkt - es kann also jetzt mit höheren Temperaturen erhitzt werden.
Bei der Raffination entstehen je nach Ölsorte außerdem mehr oder weniger hohe Mengen der als gesundheitsschädlich eingestuften Fettsäureester "3-MCDP" und "Glycidol". Diese Stoffe können nach dem Verzehr im Verdauungstrakt freigesetzt werden.
Besonders hohe Gehalte der schädlichen Stoffe werden regelmäßig in gehärteten Fetten und raffiniertem Palmöl nachgewiesen. Mittlere Gehalte dieser Schadstoffe fanden sich in raffinierten Speiseölen aus Distel, Erdnuss, Weizenkeim und Baumwollsaat. Raffiniertes Rapsöl, Sojaöl, Olivenöl, Kokosfett und Sonnenblumenöl wiesen dagegen nur sehr niedrige Gehalte vom Fettsäureester 3-MCPD und Glycidol auf.
Extraktionsverfahren zur Herstellung von Speiseöl
Das Extraktionsverfahren ist ein Trennverfahren und erfolgt mit Hilfe von Lösungsmitteln. Nach der Zerkleinerung und Pressung wird das Speiseöl aus den Zellverbänden von Samen, Früchten oder Kernen mit Hilfe eines Lösungsmittels herausgelöst. Angewendet wird dafür beispielsweise technisches n-Hexan. Das giftige Lösungsmittel lässt sich wieder entfernen, indem das Öl auf 140 °C erhitzt wird, so dass das n-Hexan verdampft.
Nach Erhitzung und Verdampfung wird das Speiseöl im nächsten Arbeitsgang raffiniert. Bei diesem Vorgang, der Temperaturen um 200 °C erfordert, lässt sich das Öl von Säure, Schleim und Farbe befreien und desodorieren. Raffiniertes Speiseöl ist in der Regel geruchlos und geschmacklos. Es ist meist durch eine helle Farbe und eine lange Haltbarkeit gekennzeichnet.
Je nach Art des Saatgutes kommen zwei Extraktionsverfahren zum Einsatz. Zum einen wird das Perkulationsverfahren eingesetzt, bei dem das Saatgut mechanisch unbelastet bleibt. Daneben kommt das Immersionsverfahren für stark rohfaserhaltige Extraktionsgüter zur Anwendung. Die Ausbeute beträgt bei beiden Extraktionsverfahren nahezu 100 Prozent. Fast alle raffinierten Pflanzenöle, außer Olivenöl, werden heute auf diese Weise gewonnen.
Doch wie sieht die Qualität und der gesundheitlicher Nutzen von Öl aus Extraktionsverfahren aus?
Nun bei dem Extraktionsverfahren bleiben wertvolle Inhaltsstoffe wie die hitzeempfindlichen Vitamine und Proteine im Pflanzenöl erhalten, während hitzeempfindliche Nährstoffe den Herstellungsprozess bei der Heißpressung nicht überstehen. Beim Extraktionsverfahren können allerdings auch Rückstände des giftigen Lösungsmittels im Speiseöl verbleiben.
Raffinierte Öle erfüllen die Kriterien für Bio-Siegel demnach nicht, weil im Verarbeitungsprozess regelmäßig unerlaubte Hilfsstoffe und Zusatzstoffe eingesetzt werden. Weitaus besser ist demnach die Kaltpressung
Kaltpressverfahren zur Herstellung von Speiseöl
Dieses Verfahren nutzt die native Kaltpressung. Beim Kaltpressverfahren in der Ölmühle werden naturbelassene, beziehungsweise native Speiseöle produziert, oftmals nur in einem Arbeitsgang. Zur Herstellung von Speiseöl presst man im Kaltpressverfahren Früchte, Samen oder Kerne von Pflanzen nach der Zerkleinerung oder dem Mahlen unter mechanischem Druck ohne Wärmezufuhr aus. Anschließend wird das Speiseöl oft gefiltert. Es entstehen bei dem Vorgang in der Regel Temperaturen von 40 bis 60 °C.
Zum Einsatz kommen beim Kaltpressverfahren Spindelpressen und Schneckenpressen. Die Ausbeute von Speiseöl durch native Kaltpressung beträgt etwa 40 Prozent.
Qualität und gesundheitlicher Nutzen von Öl aus Kaltpressung
Die native Kaltpressung bringt qualitativ hochwertige Speiseöle hervor. Sie erhält durch den Einsatz geringer Temperaturen alle gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe wie Vitamine und Fettsäuren während des Herstellungsprozesses. Kaltgepresste Öle weisen in der Regel einen intensiven Eigengeschmack auf, der immer von der verwendeten Ölsaat oder Ölfrucht abhängt.
Kommen geröstete Saaten in kaltgepresstem Speiseöl zum Einsatz, haben sie durch hohe Temperaturen bei der Röstung bereits vor dem Kaltpressverfahren wertvolle Inhaltsstoffe verloren.
Jedoch sind native kaltgepresste Öle regelmäßig auch schneller verderblich als raffinierte Öle.
Daneben gib es dann noch die sogenannten "High-Leic"-Öle. Diese biologisch hergestellte Öle sind ebenfalls kaltgepresst und bieten eine gesunde Alternative für die heiße Küche, wenn es ums Backen und Frittieren geht. Diese Speiseöle sind auch gentechnisch unbelastet und lassen sich bis zu Temperaturen von 210 °C einsetzen.
Bei kaltgepressten Speiseölen aus biologisch angebauten Früchten oder Samen gibt es viele Produkte mit einem Bio-Siegel.
Weitere Schadstoffe in Ölen und ihr Gesundheitsrisiko
Schon vor mehr als 20 Jahren setzten sich der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuss und die Mehrzahl der EU-Staaten dafür ein, dass die riskanten Substanzen verboten, beziehungsweise Höchstgrenzen in Lebensmitteln festgelegt werden. Die erlaubten Höchstgehalte für diese Schadstoffe wurden in der EU-Verordnung 2023/9/15 vom 25. April 2023 geregelt.
Polyzyklische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Speiseölen
Wenn bei der Speiseölgewinnung beispielsweise Röstverfahren, Erhitzungsverfahren, Trocknungsverfahren oder Rauchverfahren eingesetzt werden, können polyzyklische Kohlenwasserstoffe (PAK) entstehen. Beim direkten Kontakt gelangen sie in das Lebensmittel. PAK sind erbgutschädigende krebsauslösende Substanzen (genotoxische Karzinogene). EU-weit darf der Höchstgehalt für die Summe der PAK in pflanzlichen Speiseölen und in Ölen von Meerestieren 10 Mikrogramm (µg) pro Kilogramm (kg) betragen. Im Kokosöl sind hingegen 20 Mikrogramm (µg) pro Kilogramm (kg) erlaubt.
Dioxine und polychlorierte Biphenyle (PCB) in Speiseölen
Dioxine, die in Form der fettlöslichen Dibenzofurane (PCDF) und polychlorierte Dibenzo-p-Dioxinen vorkommen (PCDD), sowie auch die langlebigen polychlorierten Biphenyle (PCB) sind weitere giftige Chemikalien. Sie entwickeln sich auch in der Lebensmittelindustrie bei den thermischen Verfahren und zählen zu den unerwünschten Nebenprodukten. Auf dem Produktionsweg können sie in Speiseöle gelangen. Die Entstehung dieser Schadstoffe lässt sich bei entsprechenden industriellen Prozessen in der Regel nicht verhindern.
PCB kann in hohen Mengen Hautprobleme, darunter Akne und Hautausschläge verursachen. Experten bringen hohe Mengen auch mit Veränderungen im Blut und Urin in Zusammenhang, die Funktionsstörungen und Störungen der Fortpflanzungsfähigkeit verursachen könnten. Außerdem steht PCB im Verdacht, Krebs auszulösen.
Nach Informationen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) erhöhen einige Dioxine, das Krebsrisiko. In Tierversuchen lösten Dioxine unter anderem Funktionsstörungen im Hormonhaushalt, Immunsystem und dem Nervensystem aus. In der EU gelten für diese Substanzen in pflanzlichen Speiseölen bestimmte Obergrenzen.
Quelle: infothek-gesundheit.de
Doch wie sieht es nun mit den kaltgepressten Ölen aus?
Nun hier sollten Sie gute Native Bio-ÖLe verwenden, die sich in dunkle Flaschen befinden. Welche Öle, bzw. welche Fette hier die besten sind, haben wir ja nun ausgiebig geklärt.
Bei den Ölen sollten Sie also mehr auf Öle setzten, die ein gutes Omega-3 zu Omega-6- Verhältnis haben. Dazu zählen z.B. Leinöl, Walnussöl, Hanföl. Und gut ist aber auch Olivenöl und hin und wieder ist auch Rapsöl in Ordnung. Die meisten dieser Öle haben auch einen hohen Wert an mehrfach-ungesättigten Fettsäuren. Dadurch eigenen sich diese nicht zum anbraten, bzw. zum erhitzen, da ja sonst eben die Transfette und andere schädliche Stoffe entstehen.
Genau genommen, sind es folgende Öle, die Sie nur für die kalte Küchen verwenden sollten:
- Leinöl
- Distelöl
- Hanföl
- Walnussöl
- Sonnenblumenöl
- Kürbiskernöl
- Sesamöl (aus geröstetem Sesam)
- Weizenkeimöl
- Butter (maximal schmelzen lassen, aber nicht zum Braten verwenden)
Daneben gibt es aber auch Öle, sie sich fürs leichte dünsten und sanfte Braten eignen. Das sind diese hier:
- Olivenöl nativ extra
- Avocadoöl
- Mandelöl
- Rapsöl
- Erdnussöl
Und hier nun eine Liste von Öle und Fette, die sich zum Braten und Frittieren eigenen:
- Kokosöl (Kokosfett ist raffiniertes Kokosöl)
- Palmöl (Palmfett ist raffiniertes Palmöl)
- Ghee ( Tipp: Ghee selber machen )
- Schmalz
- High-oleic Sonnenblumenöl (Bratöl)
Wie gesagt, haben einige dieser Öle einen hohen Wert an Omega-6-Fettsäuren. Bedeutet das jetzt, dass Sie diese gar nicht verwenden sollten? Nein. Denn üblicherweise sind Öle ja kein Grundnahrungsmittel, bzw. sollten Sie ihren Vitamin und Fettsäure-Bedarf nicht allein mit Öle decken. Das wäre keine gute Idee. Insofern ist es auch nicht tragisch, wenn Sie hin und wieder mal kleine Mengen an Ölen verwenden, die einen etwas ungünstigeren Omega-6 - zu 3 Verhältnis haben. Wenn Sie sich ansonsten gut ernähren und auch anderweitig gute Fette zu sich nehmen, dann ist das schon in Ordnung.
Tatsächlich sollten Sie Öle eigentlich eher sparsam verwenden und nicht "literweise" davon in irgendwelchen selbst gemachten Salat-Dressing hinein gießen.
Doch jetzt ist es leider so, dass die Lebensmittel-Industrie gerne und oft Öle - vor allem das Sonnenblumenöl; aber auch Rapsöl - für ihre Produkte verwendet. Oftmals wird es als "Streckmittel" verwendet, oder als günstigere Alternative zu Sonnenblumenkerne. Wenn man sich beispielsweise diese ganzen veganen Aufstrich anschaut, dann basieren die meisten von denen auf Sonnenblumenöl-Basis. Angefangen hat alles eigentlich mit den Zwergewiesen-Produkte. Diese sind auf Sonnenblumenkerne-Basis hergestellt. Als es dann immer mehr wurde und auch viele andere Hersteller solche Aufstrich nachgemacht haben, haben viele Hersteller das Öl als Basis verwendet statt die Kerne. Deswegen gibt es da auch diese Preis-Unterschiede. Ja, sogar manche andere Aufstriche, die fettreich sind und auch günstiger im Preis sind, basieren auf Sonnenblumenöl-Basis. Da machen leider auch Bio-Hersteller kein Halt vor. Tatsächlich habe ich mal einen Pistazien-Creme-Aufstrich gesehen mit folgenden Zutaten: Zucker, Sonnenblumenöl, Pistazien (ca. 14 %).
Da fragt man sich wirklich wie sowas als Nuss-Creme-Aufstrich deklariert werden kann, wenn doch die beiden Hauptzutaten Zucker und Öl sind! In Wahrheit ist das doch ein Öl-Zucker-Aufstrich! Das ist schon echt krass. Zucker ist ja das schlimmste unter den isolierten Kohlenhydraten und Sonnenblumenöl ist auch eines der am qualitativ weniger guten Öle. Stellen Sie sich vor, Sie mixen Zucker mit Öl und geben ein Hauch von Pistazien hinzu. Oja, oje. Das ist eine äußert schlechte Kombination - viel Zucker und viel Fett. Das ist nicht mehr gesund - egal was die anderen Zutaten noch so sein mögen. aber diese Kombination ist eine kleine gesundheitliche Katastrophe!
Also, so ziemlich alles was "Cremes" und "Butter" ist wie Erdnussbutter, oder Mandelcreme, etc. kann aus einen Großteil aus irgendein Öl bestehen - meist eben Sonnenblumenöl, oder auch mal eben Erdnussöl oder sowas. Nur die sogenannten "muse" wie "Erdnussmus", "Mandelmus", "Haselnusmus" etc. sind vollständige zur fettreichen Brei zermahlenen Kerne oder Nüsse.
Auch wird Sonnenblumenöl und Rapsöl für Salatdressings verwendet - und ist natürlich auch Grundlage für Mayonnaise -egal ob vegan oder nicht.
Und leider ist es auch so bei den veganen Milch-Alternativen wie Haferdrink, Reisdrink, Mandeldrink. etc. Diese enthalten oft auch eine gute Menge an Sonnenblumenöl - oder stellenweise Rapsöl. Hier könnte man fast schon von "Streckmittel" sprechen. Ja, denn nehmen Sie mal ein Liter Wasser und geben Sie dann 2 oder 3 EL Sonnenblumenöl hinzu. Wenn Sie jetzt diese Mischung mixen, reicht es schon aus, dass Sie eine milchige Flüssigkeit erhalten. Jetzt brauchen Sie ja nur noch etwas Geschmack von Hafer, Reis oder was auch immer, hinzu tun, und schon haben Sie einen Pflanzendrink.
Doch natürlich gibt es auch Ausnahmen. Es gibt auch einige Hersteller, die ihren Milch-Alternativen ohne Öl herstellen. Diese sind zwar weniger, aber die gibt es auch. Bei Sojadrink ist es sogar in den meisten Fällen so, dass hier kein Öl verwendet wird. Bei Haferdrinks ist es fast immer so.
Naja, gut, aber das nur so nebenbei. Achten Sie mal bei Ihren nächsten Einkauf darauf.
Denn Sie müssen ja eines bedenken. Ein ÖL ist PURES FETT. Dieses Fett wurde ja aus den Saaten, Früchten oder anderen fettreichen Lebensmittel heraus gepresst. Übrig bleibt somit nur noch das pure Fett. Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und viele andere guten Stoffe sind somit fast vollständig nicht mehr vorhanden - außer eben ein Teil der Fettlöslichen Vitamine E, K, und A. Vitamin D kommt hier nicht vor. Jedoch sind die Mengen an diese Vitaminen nicht sehr hoch. Außer das Vitamin E kommt in manchen Ölen in größeren Mengen vor. Es würde dennoch kein Sinn ergeben jeden Tag mehrere Esslöffel Öle zu essen. Das wurde dann wieder in Richtung "ungesund" gehen. Außerdem nehmen Sie dadurch ja auch große Mengen an Kalorien zu sich. Denn bedenken Sie: 1 gramm Öl (also pures Fett) sind 9,3 Kalorien!
Und was die Fettsäuren angeht, die wir hier ausgiebig besprochen haben: Diese sollten Sie hauptsächlich ebenfalls über VOLLSTÄNDIGE Lebensmittel einnehmen und nicht über Öle. Also Beispielsweise Oliven statt ständig Olivenöl. Oder Walnüsse statt Walnussöl, und meinetwegen (gekeimte) Sonnenblumenkerne statt Sonnenblumenöl. Und dann gibt es ja auch noch Mandeln, andere Nüsse und Kerne, Avocados, gute Kokosprodukte wie Raspeln oder Kokosmehl und so weiter.
Öle sind also pures Fett. Und damit ist ein Öl ein ISOLAT! Öl ist isoliertes Fett!
Und die große Frage ist jetzt: Ist dieses isolierte Fett möglicherweise vielleicht doch nicht immer so gut für den Körper? Ist es ein Unterschied für den Körper wenn man isoliertes Fett zu sich nimmt statt dieses Fett über vollständige Lebensmittel einzunehmen?
Und genau diese Frage und einiges mehr beantworte ich im dritten und letzten Teil dieser Fett-Serie. .
Soo...
Damit wären wir also am Ende dieses zweiten Teils über Fette angekommen. Ja, ich weiß, ich wollte da noch was zu-ende erklären - das worauf ich in den Extra-Artikel im 3. Teil bei den Kohlenhydraten eingegangen bin. Ja, das werde ich noch machen. Jedoch habe ich mich entschieden, diese Erklärung im dritten Teil zum Thema Fette zu bringen. Denn dieser Text dazu wird auch nicht gerade sehr kurz werden. Und da dieser 2. Teil schon recht lang ist, finde ich es besser, diese Erklärung in einem Extra-Artikel zu schreiben. Außerdem passt es dort auch besser hin. Denn im dritten Teil werde ich noch einmal kurz auf das Cholesterin eingehen, auf eine andere Sichtweise zum Thema "Öle" (nämlich eben zum Thema "Isolat"), und dann eine grobe Zusammenfassung schreiben über das Zusammenspiel von Fetten und Kohlenhydraten was die Themen "Abnehmen", "Stoffwechsel", "Verbrennung von Fette nun Kohlenhydrate" und "Diabetes" angeht. Sie sehen also, auch im dritten Teil wird es noch einmal sehr spannend werden.
Also denn. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. :-)
Bis bald zum drittel Teil!
Herzlichst,
Sascha Markantelli
Meine Quellen:
Fettstoffwechsel und Fettverdauung
www.plusminus.de - Leben ohne Gallenblase
dasgastroenterologieportal.de - Die Galle
www.stiftung-gesundheitswissen.de - Wie funktioniert Fett-Stoffwechsel
de.wikipedia.org - Chylomikron
de.wikipedia.org - Lipoproteinlipase
fet-ev.eu - Fettverdauung
www.youtube.com - Fettverdauung
www.zentrum-der-gesundheit.de - kurzkettige Fette
www.edeka.de - Spezielle Ernährung beim Sport
www.primal-state.de - Ketogene Ernährung
www.zentrum-der-gesundheit.de - Bio Rhythmus durch Fett gestört
www.zentrum-der-gesundheit.de - Fette und Öle
Omega - Fettsäuren
www.zentrum-der-gesundheit.de - gesättigte Fette nicht so schädlich wie gedacht
ostrovit.de - Alpha Linolensäure
utopia.de - Linolsäure
www.gesundkatalog.de - Linolsäure
www.zentrum-der-gesundheit.de - Omega-Fette
Fette essen mit Omega 3 Fettsäuren
www.ufop.de - Ölsäure
www.naturafoundation.de - Omega 3 und Omega 3
www.ufop.de - Alpha-Linolsäure, EPA und DHA
www.zentrum-der-gesundheit.de - Alpha Linolensäure
www.zentrum-der-gesundheit.de - Omega 3
Arachindonsäure und Arthrose
Utopia.de - Diese Lebensmittel enthalten Arachidonsäure
flexikon.doccheck.com - Arachidonsäure
www.zentrum-der-gesundheit.de - Ateriosklerose vorbeugen
Leptin und Grehlin
www.kry.de - Diese Hormone machen Hungrig und satt
24vita.de - Ghrelin das Hungerhormon
www.aerzteblatt.de - Bedeutung von Leptin
www.gesundheitsforschung-bmbf.de - Fettreiches essen und Leptinresistenz
www.lernhelfer.de - Fette
workshopernaehrung.de - Fettlösliche Vitamine
Cholesterin
www.netdoktor.de - HDL-Cholesterin
www.youtube.com - Patric Heizmann erklärt das Problem mit Cholesterin
de.wikipedia.org - HDL
Organfett und Viszeralfett
www.focus.de - Risiko für Herz und Kreislauf
de.wikipedia.org - Viszeralfett
Hinweis zur Kommentarfunktion:
Es muss auch eine E-Mail-Adresse angegeben werden, damit der Kommentar abgeschickt wird. Dabei muss die E-Mail nicht unbedingt "echt" sein..solange das Format mit den AT-Zeichen stimmt...